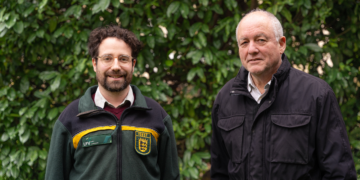Wie im fächerübergreifenden Durchschnitt sind auch in den Rechtswissenschaften deutschlandweit nur zwölf Prozent der ordentlichen Professuren weiblich besetzt. Wie sich diese Unterrepräsentation angesichts des seit Jahrzehnten hohen Anteils weiblicher Jurastudierender erklären lässt, ist Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen.
Im Jahr 1909 durften sich die ersten Studentinnen für den Studiengang der Rechtswissenschaften einschreiben. In der Folge stieg ihr Anteil an der Studierendenschaft langsam aber stetig, 1990 waren vierzig Prozent der Studierenden weiblich, aktuell liegt der Anteil bei 53 Prozent. Anders stellt sich bis heute die Situation an den rechtswissenschaftlichen Lehrstühlen dar: Deutschlandweit sind nur etwa zwölf Prozent der Professuren weiblich besetzt. An einzelnen Fakultäten, wie an der Universität Greifswald, können die Studierenden derzeit ausschließlich Veranstaltungen bei männlichen Professoren besuchen. In einem Gespräch äußert Frau Professorin Ute Mager, die Dekanin und zugleich einzige Professorin an der juristischen Fakultät Heidelberg, ihre Meinung über die hinter dieser Unterrepräsentation stehenden Gründe.
Worin sehen Sie den Grund dafür, dass nur so wenige der rechtswissenschaftlichen Professuren an deutschen Universitäten weiblich besetzt sind?
Natürlich gibt es heute keine offene Diskriminierung mehr, keine rechtliche Benachteiligung der Frau bei der Besetzung von Professuren. Ich denke, der eigentliche Grund liegt darin, dass viele Frauen einfach nicht Professorin werden wollen – meiner Meinung nach streben Frauen statistisch gesehen häufiger eine andere Work-Life-Balance an. Wer in der Wissenschaft Erfolg haben will, muss der Arbeit die oberste Priorität einräumen. Ich glaube, die Bereitschaft, sich einseitig auf den Beruf zu konzentrieren, ist bei Männern größer. Andersherum sind vielleicht Frauen nach wie vor eher bereit, die Rolle der Mutter an der Seite eines beruflich erfolgreichen Ehemannes auszufüllen. Allerdings muss man das nicht unbedingt als falsche Entscheidung ansehen. Ist es wirklich so entscheidend, beruflich erfolgreich zu sein? Mit dem Erfolg sind meist auch Kosten verbunden, die man leicht vernachlässigt.
Der Frauenanteil an den Studierenden im Jurastudium liegt schon seit Längerem über der Quote in anderen Fächern. Statistisch gesehen müsste dann aber auch der Anteil der Juraprofessorinnen über dem fächerübergreifenden Durchschnitt von zwölf Prozent weiblich besetzter Professuren liegen. Dies ist nicht der Fall. Wie erklären Sie sich das?
Gerade in der Juristerei gibt es die attraktive Alternative der Justiz – in der eine ähnliche Unabhängigkeit besteht, wo aber zugleich Familie und Beruf deutlich besser vereinbar sind. Während man als Richterin mit Anfang 30 eine Lebensstellung hat, ist eine solche für eine Habilitandin noch mit Ende 30 unsicher. Hinzukommt, dass man für das Karriereziel des Professors oder der Professorin sein gesamtes Leben mit Ende 30 noch einmal umkrempeln und insbesondere den Wohnort wechseln muss – weil der erste Ruf wegen des Hausberufungsverbots stets an eine andere Uni als die der Habilitation erfolgt. Das ist natürlich ausgesprochen ungünstig, weil das in einem Lebensalter geschieht, in dem auch die Familie gewöhnlich im Mittelpunkt steht.
Wie ist es Ihnen selbst gelungen, Ihre Karriere mit der Familie zu vereinen – Sie haben ja auch einen sechzehnjährigen Sohn?
Ich selbst war in meiner Habilitationsphase schwanger und tat mich damit schwer. Ich empfand es aber als überaus positiv, wie mein Betreuer damals damit umgegangen ist. Ich hatte wegen meines dicken Bauchs das Gefühl, dass mich keiner mehr ernst nimmt. Mein Betreuer hat mich kurzerhand hochschwanger eine Vorlesung halten lassen – das hat mir meine Zweifel genommen. Allgemein sind Kinder nicht leicht mit dem Professorenberuf zu vereinbaren. Mir ist es aber bis heute wichtiger, meinen Sohn nicht alleine zu lassen – da verzichte ich lieber auf Auslandsreisen.
Würden Sie nicht sagen, dass diese Unvereinbarkeit von Familie und Professur in Verbindung mit dem bis heute vorherrschenden Rollenbild eine Art der indirekten Diskriminierung ist, welche mehrheitlich Frauen aus den Spitzenpositionen fernhält?
Doch, das ist tatsächlich eine gesellschaftlich verwurzelte Benachteiligung. Spätestens wenn die Kinder da sind, greift eben bis heute in vielen Partnerschaften die traditionelle Rollenverteilung. Zumindest war das in meiner Generation noch so – vielleicht ändert sich das bei Ihnen langsam. Eine echte Diskriminierung gibt es meines Erachtens aber nicht. Es gibt nur unreflektierte Wahrnehmungen von Kompetenz oder Inkompetenz. Das sind nur schwer greifbare, unterschwellige Einstellungen, die die Menschen nicht einmal selbst unter Kontrolle haben und die sich vielleicht jetzt langsam ändern.
Wie kann man auf eine Änderung dieser unbewussten Rollenbilder hinwirken? Die rechtswissenschaftliche Lehre ist teilweise stark männlich geprägt – selbst in Fallbeispielen tauchen fast ausschließlich männliche Beteiligte auf. Frauen spielen allenfalls eine Rolle als Geliebte, der ein Sparbuch zugewendet wird, oder als Ehegattin, die unbefugt über Hausratsgegenstände verfügt. Als wie relevant sehen Sie die männliche Dominanz im akademischen Bereich an und wie kann man daran etwas ändern?
Eine solche Prägung gibt es tatsächlich. Ich versuche daher, in meinen Vorlesungen bewusst andere Fallbeispiele zu bilden und auch einmal eine Unternehmerin oder eine Bauherrin handeln zu lassen – aber die Studierenden neigen in der Fallbearbeitung schnell dazu, die Beteiligten wieder in männliche Akteure umzubenennen. Vermutlich sind sie einfach daran gewöhnt. Ich finde es aber durchaus wichtig, deutlich zu machen, dass es Alternativen gibt – denn die Sprache prägt das Denken. Unsere Sprache ist aber bis heute durch das Männliche dominiert. Das atmen wir ein wie die Luft, in der wir leben – und dem gilt es bewusst gegenzusteuern.
Würden Sie sagen, dass die Unterrepräsentation der Frauen in der juristischen Wissenschaft das Recht auch inhaltlich prägt? Wäre das Recht ein anderes, wenn Frauen mehr an seiner Weiterentwicklung mitwirken würden?
Nein, das entspricht nicht dem Ideal des Rechts. Das juristische Denken soll dazu befähigen, objektiv zu urteilen – die blinde Iustitia soll ja auch versinnbildlichen, dass individuelle Eigenschaften und Unterschiede zwischen den Einzelnen, wie etwa das Geschlecht, nicht ins Gewicht fallen. Ausgehend von diesem Ideal des Rechts halte ich auch nichts von einer Auffassung, nach welcher ich als Frau mich mit Rechtsfragen anders beschäftigen würde oder müsste, bloß weil ich eine Frau bin. Im Sinne einer umfassenden Repräsentation aller Gesellschaftsmitglieder in unserer Rechtsordnung ist es aber wünschenswert, dass unter denen, die an der Erarbeitung und Fortentwicklung des Rechts mitwirken, eine größtmögliche Pluralität herrscht. Und als mich vor kurzem ein paar junge Studentinnen angesprochen haben, dass es sie stolz mache, dass eine Frau Dekanin der Juristischen Fakultät sei – da habe ich mich gefreut.
Das Gespräch führte Victoria Otto