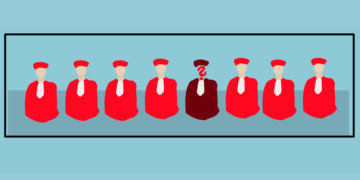ruprecht-Redakteuer Ziad-Emanuel Farag hat die Novellierung des Landeshochschulgesetzes unter die Lupe genommen und festgestellt, dass selbst die neue Verfasste Studierendenschaft wohl wenig an den festgefahrenen Strukturen der Universitätsgremien ändern kann.
Wissenschaftsministerin Bauer und die soziale Auslese
Die Wissenschaftsministerin Theresia Bauer verfolgt eine neoliberale Bildungspolitik. In dieser ist Bildung eine Ware, das Recht auf Bildung rückt hier in den Hintergrund. An den Hochschulen ist nicht die Partizipation aller Mitglieder die Maxime, sondern ein straffes, hierarchisches Gerüst. Das zeigen die aktuellen Entwicklungen bei der Novellierung des Landeshochschulgesetzes, wenn man sie in einem größeren Zusammenhang betrachtet. Ein großes Versprechen im Koalitionsvertrag der grün-roten Landesregierung war die soziale Öffnung der Hochschulen. Es sollte nicht mehr vom Geldbeutel der Eltern abhängen, wer was an welcher öffentlichen Hochschule studiert. Mit der Abschaffung der Studiengebühren, schien die grün-rote Regierung dies sofort umzusetzen. Doch kurze Zeit später sollten doch wieder die Studierenden als einer der finanzschwächsten Gruppen für die Haushaltssanierung herhalten. Der Verwaltungskostenbeitrag an den Hochschulen wurde im Dezember 2012 von 40 auf 60 Euro erhöht, ohne dass die Verwaltungskosten gestiegen wären. Noch schlimmer wäre es beinahe vor gut einer Woche gekommen: Bis zum 9. November wollte die grün-rote Landesregierung Gebühren für Studierfähigkeitstests und Eignungsprüfungen an den Hochschulen in Höhe von 100 Euro erheben. Bisher lag dies im Ermessen der Hochschulen. Auf Antrag der linken Parteimitglieder sprach sich der Landesparteitag der Grünen in Esslingen mit mehr als 85 Prozent der Stimmen dagegen aus (Zum Interview mit Jörg Rupp, erweitertes Vorstandsmitglied) An der geplanten Erhöhung des Höchstsatzes von 50 Euro auf 100 Euro ändert das nichts.
Ursprünglich sah der Antrag auf dem Parteitag vor, Gebühren für Studierfähigkeitstests gesetzlich auszuschließen. Dies hätte für Studieninteressierte eine Verbesserung ihres bisherigen Status bedeutet. Auf dem Parteitag einigten die Grünen sich in Anwesenheit von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer nun auf diesen Kompromiss. Doch die Hochschulen dürfen ähnliche Gebühren weiterhin selbst einführen.
Studierfähigkeitstests sind verfassungswidrig
Studierfähigkeitstests sind kein Nischenthema für Musik- oder Kunsthochschulen. An der Universität Heidelberg gibt es viele solcher Eignungsprüfungen wie in der Anglistik. Diese Regelung kann auf alle Fächer außer Germanistik und Mathematik ausgeweitet werden. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer sagte, dass diese Prüfungen das Abitur ergänzen. „Dieses Argument ist absurd. Das Abitur berechtigt zum Hochschulzugang, wieso sollte man noch zusätzliche Aufnahmeprüfungen und Auswahlverfahren absolvieren?“, sagt allerdings Cendrese Sadiku, Referentin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. In ihrer Argumentation hat sie das Bundesverfassungsgericht mit dem Numerus-Clausus-Urteil aus dem Jahr 1972 auf ihrer Seite. Demnach hat jeder mit einer allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung – wie dem Abitur – das Recht, zu studieren was er will. Dies garantiert Artikel 12 des Grundgesetzes, der das Recht auf freie Berufswahl garantiert. Zulassungshürden sind nur dann möglich, wenn es kurzfristig zu wenige Studienplätze gibt. Mittelfristig ist dieser Mangel zu beheben.
Grundgesetz-Artikel 12 ist grün-rot nicht wichtig
Die Zulassungsbeschränkungen werden immer noch nicht abgebaut. Im Gegenteil verschärfen die Hochschulen sie weiterhin, indem sie solche Gebühren erheben. „Die Studieninteressierten werden dann für die von ihnen nicht verschuldete Knappheit von Studienplätzen persönlich zur Kasse gebeten. Sie müssen privat für das Versagen des Staates bezahlen“, sagt Torsten Bultmann vom Bund der Demokratischen WissenschaftlerInnnen.
Die Gebühren werden schnell zu einer hohen sozialen Hürde, wenn die Hochschulen landesweit Studierfähigkeitstestsgebühren einführen. Das zeigt aktuell ein Blick auf die Fächer Anglistik und Romanistik: In Baden-Württemberg lassen sich diese Fächer nur in Freiburg, Heidelberg, Mannheim, Konstanz, Tübingen und Stuttgart mit dem Studienabschluss „gymnasiales Lehramt“ oder Bachelor studieren. In Heidelberg und Freiburg gibt es bereits Eignungsfeststellungsprüfungen. Um einen Studienplatz zu erhalten, sind Mehrfachbewerbungen nötig. Wenn die Universitäten Heidelberg und Freiburg jeweils 100 Euro dafür verlangen sollten, gibt es die größtmögliche Chance auf einen Studienplatz nur für Bewerber, die 200 Euro in die Auswahlprüfungen investieren. Der beschlossene Antrag des grünen Parteitages sieht vor, dass für Bewerber*innen keine Mehrfachbelastungen entstehen dürfen, wenn sie mehrere kostenpflichtige Studierenfähigkeitstests absolvieren. Die Frage ist: Wer kommt dann für den finanziellen Ausfall aus Sicht der Hochschulen auf? Oder müssen sich die betroffenen Hochschulen das Geld teilen?
So oder so, stellen die Bewerbungsgebühren noch einen selektiveren Faktor als die Studiengebühren dar: Soziale Abfederungsmaßnahmen fehlen. Das Geld wird unter Umständen vergeblich ausgegeben. Das dürfte Abiturienten, die auch eine Ausbildung oder ein duales Studium in Erwägung ziehen, zusätzlich von einem Studium fernhalten: Dort gibt es sofort ein Einkommen. Dass man gegen soziale Selektion bei einer grünen Landesregierung einen enormen Aufwand betreiben muss, um sie zu verhindern und der Parteitag einschreiten muss, ist bezeichnend für die politische Position von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer.
Weiterhin Gebühren für verpflichtende Fremdsprachen
Dementsprechend können die Hochschulen weiterhin Gebühren erheben, wenn Studierende sprachliche Zugangsvoraussetzungen wie eine Fremdsprache zu ihrem Studium noch nicht erfüllen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie wie im Falle des Latinums die Umstände oftmals gar nicht zu vertreten haben, weil es zum Beispiel kein entsprechendes Angebot an ihrer Schule gab. „Wenn ich gezwungen bin, diese Kurse zu belegen, darf das nichts kosten. Das wollen sie nicht einmal rückgängig machen“, sagt dazu Bultmann. Es bleibt abzuwarten, welche Fächer an welchen Universitäten in diese Gebühren einführen, um ihre finanzielle Situation zu verbessern.
Öffnung für Geduldete
Positiv ist, dass Ausländer, die sich in Deutschland lediglich aufhalten dürfen, ohne zu arbeiten, oder geduldet werden, jetzt in Baden-Württemberg ein Studium offen steht: „Die GEW-Baden-Württemberg begrüßt die Öffnung des Hochschulzugangs für Flüchtlinge mit Aufenthaltsgestattung oder Duldung ausdrücklich. Es ist erfreulich, dass durch die Änderung des Landeshochschulgesetzes (LHG) in Zukunft Flüchtlingen, die im Asylverfahren sind oder eine Duldung haben, die Aufnahme eines Studiums ermöglicht wird“, sagt Sadiku.
Das Studium unterliegt neoliberaler Leistungslogik
Zudem müssen Prüfungsordnungen nun Regelungen für Studierende mit Kind oder chronisch Kranke und Behinderte vorsehen. Bis her musste dies oft individuell eingeklagt werden, denn übergeordnetes Recht ist es schon längst. Andere Regelungen im Bereich Studium und Lehre aus dem vorherigen Jahrhundert bleiben zumindest erhalten, so zum Beispiel die Möglichkeit, Studierenden bei Überschreiten einer gewissen Studiendauer das Recht zu nehmen, Prüfungen abzulegen. Beibehalten wird auch die verpflichtende Orientierungsprüfung, die bei Nichtbestehen schon nach drei Semestern die Studenten bundesweit aus ihren und verwandten Studiengängen ausschließt. Dass dabei weiterhin nicht alle Studierenden abhängig vom individuellen sozialen Hintergrund nicht die gleichen Chancen haben und sozial benachteiligte Studierende, die neben dem Studium arbeiten müssen, unter massiven Druck gesetzt werden, spielt keine Rolle. Theresia Bauer hat kaum Gespür für eine soziale Hochschulpolitik.
Weiterhin unternehmerischer Existenzkampf statt Demokratie und fachlicher Vielfalt
Einhergehend mit der sozialen Öffnung der Hochschulen sollte zu Beginn der Legislaturperiode auch die unternehmerische Hochschule abgeschafft werden. Unter diesem Begriff versteht man ein Hochschulmodell, das zum Beispiel den Universitäten weitgehende Autonomie garantieren soll. Demnach geben sie sich selbst ein Profil, durch das sie sich im Wettbewerb um Drittmittel wie beispielsweise der Exzellenzinitiative durchsetzen müssen. Was unspektakulär klingt, ist in Wahrheit gerade für eine Volluniversität wie die Universität Heidelberg sehr bedrohlich. Rektor Bernhard Eitel erklärte dem ruprecht im Jahr 2012 gegenüber die finanzielle Situation der Universität Heidelberg: Die Grundfinanzierung reiche nicht aus. Bei den Mittel aus der Exzellenzinitiative gehe es demnach um „Gedeih und Verderb“ der Hochschule. In dieser Situation sind Drittmittel für die akademische und geistige Vielfalt eine große Gefahr an der Hochschule. Klar ist: Wenn Bund und Land keine Mittel bereitstellen, werden freiwerdende Professuren anderer Fächer hierfür herangezogen. Ein Beispiel ist eine Professur für Technische Informatik, die 2010 in eine für Fundamentale Physik umgewidmet wurde. Dabei werden die demokratischen Strukturen der Universität ausgehöhlt: Formal müssen die Gremien wie der Senat einer solchen Umwidmung zustimmen, in denen auch die Studierenden vertreten sind, um deren Lehre es bei Professuren schließlich geht.
Doch bei der Verfassung der Anträge im Vorfeld der Exzellenzinitiative ist dies nicht der Fall. Der Antrag liegt in der Verantwortung des Rektorats. Wen es beteiligt, ist ungeachtet der weitreichenden Konsequenzen seine Sache. Dass die Universitäten zum Existenzkampf gegeneinander um Drittmittel, ohne die sie ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen können, gedrängt werden, ist der Ausdruck der unternehmerischen Hochschule schlecht hin. Die grün-rote Landesregierung ist mit dem Versprechen angetreten, die unternehmerische Hochschule abzuschaffen. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer bezeichnet trotzdem eben jene Exzellenzinitiative als das beste, was es im Hochschulbereich gäbe.
Hierarchisch-unternehmerische Strukturen mit neuem Gewand
Der Vorsitzende und der Vorstand heißen im Landeshochschulgesetz wieder Rektor und Rektorat, an der hierarchischen Struktur ändert sich jedoch wenig: Die demokratischen Mitwirkungsrechte von Fakultäten und Fächern sind stark begrenzt. So können die Leiter der Fakultäten, die die Verantwortung für die Angelegenheiten aller Fächer in Studium und Lehre an der Universität tragen, wie bisher nur vom Rektor vorgeschlagen werden. Die Fakultäten können lediglich zustimmen oder ablehnen. Wie bisher wird die universitäre Öffentlichkeit nicht an den Beschlüssen der Gremien beteiligt. Die Gremien tagen weiter hinter verschlossenen Türen, obwohl eben alle und gerade die Studierenden in Form von Studium, Lehre davon betroffen sind.
Auch an der professoralen Mehrheit in den entscheidenden Gremien wie dem Senat ändert sich nichts. Das ist zwar historisch begründet: Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes besagt, dass Professoren in diesen Gremien wegen der im Grundgesetz verankerten Freiheit von Forschung und Lehre die Mehrheit haben müssen. Mittlerweile ist diese Auslegung überholt, da es mit den Hochschulräten oder dem Universitätsrat in Heidelberg entscheidende Gremien gibt, in denen die Professoren durch die externen Mitglieder aus Gesellschaft und Wirtschaft keine Mehrheit mehr haben.
Die TU Berlin und Nordrhein-Westfalen zeigen den Weg
Daher hat die Technische Universität Berlin beschlossen, dass der erweiterte Senat, der auch den Rektor wählt, paritätisch besetzt wird. Die vier Statusgruppen der Professoren, Studierende, akademische Mitarbeiter sowie die Verwaltung haben jeweils gleich viele Stimmen. Was revolutionär klingt, ist in Wahrheit keine weitgreifende Umwälzung: Schließlich handelt es sich bei diesem Modell um ein Zensuswahlrecht, das bereits der Staat Preußen vor der Abschaffung der Monarchie bis 1918 praktiziert hat.
In Nordrhein-Westfalen steht ebenfalls eine Novellierung des Landeshochschulgesetzes an. Hier verfolgen SPD, Linke und Grüne das Ziel von paritätisch besetzten Gremien, ohne es den Hochschulen vorzuschreiben. Gleichzeitig wird die Möglichkeit geschaffen, dass es auch studentische Rektoratsmitglieder geben kann. Davon ist bei den Parteifreunden der SPD und Grünen in Baden-Württemberg nichts zu erkennen. Die Einführung der Verfassten Studierendenschaft und der Studierendenrat sind hier nur bedingt ein Einwand: Sie ändert an den Machtverhältnissen in den Gremien der Universität nichts. Sie ist nur vergleichbar mit einer Gewerkschaft für Beschäftigte die politische Stimme der Studierenden. Dies hat aber die Landesregierung von Anfang an erkannt. Ministerin Theresia Bauer bezeichnete die Einführung der Verfassten Studierendenschaft als Selbstverständlichkeit.
Eine Stärkung des Senats bleibt aus
Ein weiteres Problem ist der Hochschulrat selbst. Getreu dem Motto des Gesetzesentwurfs, Worte statt Taten sprechen zu lassen, heißt er ab sofort nicht mehr Aufsichtsrat. Dass er an der Spitze einer unternehmerisch-hierarchischen Struktur steht, wird dagegen beibehalten. Die Aufgabe des Gremiums ist nach wie vor wie in einem Unternehmen, das Rektorat zu kontrollieren. Es ist immer noch nicht vorgeschrieben, dass in diesem Gremium Vertreter aller Statusgruppen mitwirken können. Aktuell ist ein Studierender Mitglied im Hochschulrat.
Das Landeshochschulgesetz ist nun in der Anhörung. Änderungen sind noch möglich. Ganz wesentlich neben öffentlicher Kritik von Studierenden, Hochschulgruppen, Parteien und Gewerkschaften wird dafür sein, wie viel Kritik sich auf der Beteiligungsplattform erheben wird.
Ziad-Emanuel Farag