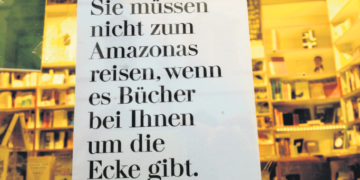Ein Zusammenschluss von studentischen Arbeitsgruppen hat eine Initiative zur Erneuerung der Lehre in der Ökonomik angestoßen. Der Heidelberger Arbeitskreis Real World Economics war von Anfang an dabei.
Raus aus dem Elfenbeinturm: Die Volkswirtschaftslehre (VWL) soll wieder vielfältiger und wirklichkeitsnäher werden. Das fordert zumindest eine wachsende Bewegung von Wirtschaftsstudenten auf der ganzen Welt. Sie haben sich zu einem Netzwerk zusammengeschlossen, um ihrer Stimme mehr Gewicht zu verleihen und Reformen durchzusetzen, die wieder mehr Platz für alternative Ideen in der VWL schaffen sollen. Grund für den Protest ist die einseitige Konzentration auf die sogenannte neoklassische Schule, die an den meisten Universitäten – einschließlich Heidelberg – andere Sichtweisen fast vollständig verdrängt hat.
Der AK Real World Economics (RWE) organisiert deshalb Vorträge und Diskussionen aus dem gesamten Spektrum pluraler Ökonomik. Hier findet die im Studium verloren gegangene Diskussionskultur Platz und man kann sich mit Kommilitonen kritisch mit Gelerntem (und Nicht-Gelerntem) auseinandersetzen. „Wir wollen nicht die Abschaffung der Neoklassik, sondern dass sie um andere Theorien ergänzt wird“, sagt Leonie Guerrero Lara. Auf Initiative des Arbeitskreises wurde daher das Modul „Geschichte des Ökonomischen Denkens“ in den Lehrplan aufgenommen. Die Bachelor-Studentin hält dies zwar für einen Schritt in die richtige Richtung, findet aber, dass die gelehrten Theorien viel stärker in den Kontext ihrer Entstehung gesetzt werden müssten. Als die Allgemeine Gleichgewichtstheorie im 18. und 19. Jahrhundert aufkam, gab es beispielsweise noch keine global agierenden Konzerne und Banken, die in heutiger Form Marktmacht ausüben konnten.
Ähnliche Gruppen wie RWE gibt es mittlerweile an 15 deutschen Universitäten. Sie haben sich zum Netzwerk Plurale Ökonomik zusammengeschlossen, das Ende 2012 in Heidelberg gegründet wurde. Es soll die Koordination zwischen den Arbeitsgemeinschaften erleichtern; man trifft sich auf Tagungen und tauscht sich aus. Demnächst soll auf pluralowatch.de ein Ranking erscheinen, das die Vielfalt von Lehre und Forschung in der VWL bewertet, um Studenten die Wahl ihrer Universität zu erleichtern.
Die Endlichkeit von Ressourcen, Konsequenzen von Umweltzerstörung, die nationale und globale Ungleichheit der Einkommensverteilung – die Liste der Probleme ist lang. Der Aufstand der Studenten erwächst auch aus der Frustration, dass im Studium die Beschäftigung mit essentiellen Fragen nicht stattfindet, wenn diese das System in Frage stellen. Dass sich der Ressourcen-Konsum auf heutigem Niveau nicht aufrechterhalten lässt, unabhängig davon, ob dies überhaupt erstrebenswert ist, ist keine abstrakte Drohkulisse mehr. In absehbarer Zeit wird es etwa kein Öl mehr geben, was Fragen nach einer Post-Wachstums-Ökonomie aufwirft. „Wir analysieren nur, wie die Situation gerade ist, und in der Forschung würde man erwarten, dass man sich auch damit beschäftigt, ob man sich vielleicht ein alternatives System zur Ressourcen-Allokation vorstellen kann. Das gibt es einfach nicht und wir müssten auch mal außerhalb der Box denken“, meint Daniel Dieckelmann vom RWE. Wenn die VWL nicht nach – manchmal auch utopischen – Lösungskonzepten sucht, verliert sie an Bedeutung, denn die meisten Studenten schreiben sich aufgrund von politischem Interesse ein. Die Studentenzahlen sind in Deutschland seit Jahren rückläufig.
Im Gegensatz zu allen anderen Sozialwissenschaften erhält man in Heidelberg für VWL keinen Bachelor of Arts, sondern einen Bachelor of Science. In den Hintergrund rückt dabei oftmals die Tatsache, dass die VWL eine Sozialwissenschaft ist, die sich klar von Naturwissenschaften unterscheidet. Ökonomik nimmt sich eine plastische Gesellschaft als Forschungsgegenstand, in der es keine allgemeingültigen Gesetze geben kann. Um treffende Analysen muss dabei immer wieder neu gerungen werden.
Die VWL selbst verändert die Gesellschaft, indem sie politisches Handeln beeinflusst. Die neoklassische Lehre verliert jedoch aus dem Blick, dass VWL notwendigerweise ideologisch und politisch geprägt ist, und erhebt stattdessen den Anspruch, unabhängig davon allgemeingültige Erkenntnisse zu gewinnen.
Die mit der VWL verwandten Fächer Politikwissenschaft und Soziologie hingegen pflegen ihre pluralistische Tradition und lassen sich nicht auf eine Strömung festlegen. Schon in den Einführungsveranstaltungen wird der Unterschied deutlich: Während die Einführung in die Politische Wissenschaft das Fach zunächst systematisiert und die unterschiedlichen Denktraditionen aufzeigt, werden in der VWL stattdessen die Grundzüge der Neoklassik erklärt, ohne andere Sichtweisen auch nur zu erwähnen. Ein Diskurs über die angewandten Theorien und Konzepte findet schlicht nicht statt. Das ist für viele Studenten, die VWL studieren, um die Zusammenhänge und Funktionsweisen in der Wirtschaft zu verstehen, intellektuell nicht befriedigend und erklärt Arbeitsgruppen wie RWE oder die Hochschultage Nachhaltigkeit. Man kann von Studenten erwarten, dass sie in Eigeninitiative über das Studium hinaus weiterdenken, aber rechtfertigt es die Aufgabe der Vielfalt in der Lehre?
Inzwischen haben sich 65 Arbeitsgemeinschaften aus 30 Ländern auf der ganzen Welt in der International Student Initiative for Pluralism in Economics, kurz ISIPE, organisiert. Sie haben einen offenen Brief verfasst, der ihre Anliegen formuliert. Der wohl prominenteste Unterzeichner ist der französische Ökonom Thomas Piketty, dessen gefeiertes Buches „Das Kapital im 21. Jahrhundert“ der Bewegung neuen Auftrieb gegeben hat. Schnell stand es auf Platz eins der Sachbuch-Bestsellerlisten und wurde als entscheidendes Werk einer neuen VWL gerühmt. Seine These ist dabei relativ einfach: Wenn die Kapitaleinkünfte das Wirtschaftswachstum übersteigen führt dies zu einer hohen Vermögenskonzentration. Man könnte auch sagen, ungezügelter Kapitalismus macht die Reichen immer reicher, während die breite Masse der Bevölkerung nicht angemessen am Wohlstand teilhaben kann. Die ungleiche Vermögensverteilung führe zu einer stagnierenden Wirtschaft und gefährde die Demokratie. Im Prinzip habe sich an den Vermögensverhältnissen seit 200 Jahren nicht viel verändert.
Solche Thesen polarisieren; die einen nennen ihn einen Vordenker, die anderen einen verkappten Marxisten. Eine treffende Kritik, die darüber hinausgeht, Piketty als Marxisten zu bezeichnen, lässt jedoch noch auf sich warten. Piketty hat am Massachusetts Institute of Technology und der École d’Économie de Paris gelehrt und seine Bilanz ist ernüchternd: „Um es klar zu sagen, die Wirtschaftswissenschaften müssen ihre kindliche Leidenschaft für die Mathematik überwinden und für rein theoretische und oft höchst ideologische Spekulation, die auf Kosten von historischer Forschung und Zusammenarbeit mit anderen Sozialwissenschaften geht.“
Das Weltbild der neoklassischen Ökonomie stammt nicht, wie zu erwarten, von einem Wirtschaftswissenschaftler oder Philosophen, sondern von keinem geringeren als Sir Isaac Newton. Ausgehend von dessen mechanistischem Weltbild wollten die Väter der Neoklassik ein System entwickeln, das für die Ökonomik erreicht, was Newton durch seine Gesetze für die Physik geschafft hat. Individuen gehorchen danach mechanischen Gesetzen, denen sie vollständig unterworfen sind, sodass ihr Verhalten theoretisch in einem deterministischen Gleichungssystem zu beschreiben ist, das es zu lösen gilt. Dazu entwickelten sie das Modell des Homo oeconomicus, des rationalen und auf seine hedonistischen Triebe reduzierten Menschen.
Im Zentrum der klassischen und neoklassischen Ökonomik steht der Gedanke, dass Systeme sich von allein in einem Gleichgewicht einpendeln, wenn sie ungestört funktionieren. Ziel ist es deshalb im Grunde den Schnittpunkt zweier Kurven zu finden, die zuvor aufgrund von verschiedenen Annahmen modelliert wurden. Diese Annahmen müssen aber so stark sein, dass die Untersuchung zum reinen Gedankenspiel wird. Für die Modelle wird zum Beispiel Rationalität sowie perfekte Information der Akteure vorausgesetzt, worüber Psychologen und Soziologen wohl nur müde lächeln können. Die Mathematik gibt der Analyse den falschen Schein von Objektivität, obwohl die Berechnung auf höchst spekulativen Annahmen beruht.
Die heutige Methodik war dabei nicht immer so selbstverständlich, wie sie heute erscheint. Als 1883 die Disziplin der VWL noch in den Kinderschuhen steckte, entbrannte ein erbitterter Methodenstreit zwischen Carl Menger, dem Gründer der Österreichischen Schule, und der Leitfigur der damaligen Historischen Schule, Gustav Schmoller. Nachdem Schmoller eine Abhandlung von Menger, die die theoretische Analyse verteidigte, in einer Rezension verrissen hatte, antwortete dieser mit einem wütenden Pamphlet: „Wie fremde Eroberer haben die Historiker den Boden unserer Wissenschaft betreten, um uns ihre Sprache und ihre Gewohnheiten – ihre Terminologie und ihre Methodik – aufzudrängen […]. Diesem Zustande muss ein Ende bereitet werden.“ Daraufhin druckte Schmoller in seinem Jahrbuch eine Ankündigung, er könne Mengers Schrift nicht beurteilen, er habe sie direkt wieder zurückgeschickt.
Schon zu dieser Zeit war der Methodenstreit ideologisch aufgeladen. Damals hatte Menger insofern Recht, als dass die Historiker die VWL dominierten und die Kontroverse schien sich mit der Erkenntnis aufzulösen, dass beide Herangehensweisen wichtig sind. Heute ist es andersherum und die mathematisch-theoretische Methodik dominiert allein Forschung und Lehre.
Nachdem die neoklassische Schule keine Antwort auf die Große Depression in den 1930er Jahren geben konnte, sprang John Maynard Keynes in die Bresche. Keynes war ein erstklassiger Mathematiker, ausgebildet an der University of Cambridge, und als er sich der VWL zuwendete, war er erschrocken, dass die Mathematik dort in sinnloser Weise auf unpassende Probleme angewandt wurde. In seinem Hauptwerk verzichtet er weitgehend auf Mathematik. Erst nach seinem Tod machten sich neoklassische Ökonomen seine Theorien zu eigen und mathematisierten sie, wobei sie die Teile, die nicht hineinpassten, ausließen.
Heute wird nur diese mathematisierte Form gelehrt; Keynes ursprüngliche Texte spielen im Studium keine Rolle. Zweifellos sollte kein Wirtschaftsstudent die Universität ohne eine solide Ausbildung in Statistik und Mathematik verlassen. Sie bieten unverzichtbares Handwerkszeug zur Analyse und Interpretation von ökonomischen Zusammenhängen. Aber zu oft werden weitreichende Konzepte wie „Nutzen“ nur angewendet, anstatt sich zu zunächst damit zu beschäftigen, was Nutzen an sich überhaupt darstellt. „[Es] wird zu selten darüber nachgedacht, ob und warum diese Methoden angewandt werden sollten, welche Annahmen zugrunde liegen und inwieweit die Ergebnisse verlässlich sind“, formuliert die ISIPE in ihrem offenen Brief. „Neben den für gewöhnlich gelehrten, auf der Neoklassik basierenden Ansätzen ist es notwendig, andere Schulen einzubeziehen. Beispiele für diese Schulen sind die klassische, die post-keynesianische, die institutionelle, die ökologische [und] die feministische […] Tradition. Die meisten Studierenden der Volkswirtschaftslehre verlassen die Universität, ohne jemals von einer dieser Perspektiven auch nur gehört zu haben.“
Ein Grund für die einseitige Ausrichtung der Lehre in der VWL liegt auch darin, dass die Theorien, auf denen die neoklassische Schule beruht, sämtlich aus dem anglo-amerikanischen Raum stammen und somit auch kulturell dieselbe Herkunft haben. Diese Länder stehen in einer liberalistischen Tradition; speziell in den USA ist laissez-faire quasi ein Dogma. Dort wurde die Forschung speziell in der Nachkriegszeit einseitig gefördert. Im ideologischen Kampf der Systeme, liberale Marktwirtschaft gegen Planwirtschaft, stand die Richtigkeit des eigenen Systems nicht zur Diskussion und diese Einstellung hat sich bis heute nicht geändert.
Wer als Ökonom eine Karriere in der Forschung anstrebt, muss sich dieser Denkweise anschließen, denn entscheidend für die akademische Reputation ist die Publikation in bestimmten US-amerikanischen Zeitschriften. The American Economic Review, das Quarterly Journal of Economics und das Journal of Political Economy gelten dabei als die prestigeträchtigsten; sie veröffentlichen bevorzugt neoklassische Artikel. Dieses Anreizsystem führt dazu, dass sich die Forschung in den letzten Jahrzehnten immer weiter von anderen Ansätzen abgewandt hat.
Das Global Power Project, das ausgehend von der kapitalismuskritischen Occupy-Bewegung gegründet wurde, untersucht die Netzwerke von Banken und Konzernen und deren Einfluss auf andere Institutionen. Dazu wurden die Mitgliedschaften von Funktionären aufgelistet und das Ergebnis ist, dass Manager der maßgeblich an der Finanzkrise beteiligten Banken Goldman Sachs, JPMorgan Chase und anderen an fast allen bedeutenden Universitäten, wie Stanford, Yale oder der London School of Economics, Positionen innehaben oder -hatten. Inwiefern dies die Forschung beeinflusst, ist nur schwer bis überhaupt nicht nachzuvollziehen. Fest steht jedoch, dass es wissenschaftlich nicht unbedenklich ist, wenn in Universitäten Führungspositionen mit Bankern besetzt werden, die ein direktes oder indirektes Interesse an bestimmten Ergebnissen haben.
Die Verfasser der Petition haben richtig erkannt: „Die Lehrinhalte formen das Denken der nächsten Generation von Entscheidungsträgern und damit die Gesellschaft, in der wir leben.“ Wenn Studenten ein ganzes Studium unter der Prämisse „Mehr ist besser“ denken und arbeiten, werden viele diesen Gedanken verinnerlichen und ihn unbewusst als Entscheidungsgrundlage annehmen. Die Studenten werden zu den rationalen Nutzenmaximierern erzogen, von denen sie ständig sprechen.
Zugunsten eines einheitlichen Systems wird die Vielfalt der Theorien aufgegeben. Unabhängig davon, ob ein Theoriegebäude Anspruch auf Gültigkeit erheben kann, ist Pluralismus grundsätzlich erstrebenswert, denn verschiedene Ansätze, Methoden und Theorien führen zu unterschiedlichen Ergebnissen, die sich deshalb aber oft nicht ausschließen, sondern gegenseitig bereichern. ISIPE schreibt in ihrem offenen Brief: „Wir maßen es uns nicht an, die endgültige Richtung zu kennen, sind uns aber sicher, dass es für Studierende der Ökonomie wichtig ist, sich mit unterschiedlichen Perspektiven und Ideen auseinanderzusetzen. Pluralismus führt nicht nur zur Bereicherung von Lehre und Forschung, sondern auch zu einer Neubelebung der Disziplin. Pluralismus hat den Anspruch, die Ökonomie wieder in den Dienst der Gesellschaft zu stellen.“
In den Worten der Neoklassik: Das Monopol einer einzigen Schule macht den Markt für ökonomisches Denken ineffizient; der Nutzen wird nicht maximiert. Es bedarf deshalb endlich weniger Subvention und weniger Regulation in Lehre und Forschung, sodass die VWL im freien Wettbewerb der Gedanken ihr Gleichgewicht wiederfinden kann. Die VWL kann viel mehr sein als die akademische Lobotomie, die sie heute oft zu sein scheint, nämlich eine erkenntnisreiche Beschäftigung mit der Gesellschaft. Alternative Ideen und Ansätze gibt es genug. Man muss sie nur wiederentdecken.
von Jonathan Perisic