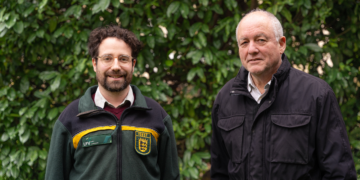Wilhelm Genazino ist Inhaber der diesjährigen Heidelberger Poetikdozentur. Ein Gespräch über Heimat, Jugend und die Notwendigkeit von Kunst.
Herr Genazino, was hat Sie dazu bewogen, die Heidelberger Poetikdozentur anzunehmen?
Es kam überraschend. Ich habe nicht gedacht, dass nochmal eine Poetikdozentur kommen wird und dachte, mein Repertoire sei erschöpft. Ich musste drei Themen finden, die für mich auch neu sind: Überempfindlichkeit, Heimat, Form.
Sind dies auch Themen, die Sie persönlich bewegen?
Ja, wobei der Begriff Heimat für mich sehr neu ist. Ich habe mit Heimat nicht viel am Hut, aber ich habe dann überlegt, dass das ungerechtfertigt ist.
Wo sind Sie beheimatet?
Ich komme aus Mannheim und habe mich die längste Zeit meines Lebens dieser Stadt geschämt. Wenn ich da meine Verwandten getroffen habe, die haben mich sofort beschämt, schon durch ihren merkwürdigen Dialekt und ihre völlig beschränkte Optik. Ich dachte: „Mein Gott, was für Leute sind das, die sind meine Verwandten?“
Welchen Bezug haben Sie zu Heidelberg?
Für mich ist Heidelberg genauso Heimat. Wir haben oft Klassenfahrten nach Heidelberg gemacht.
Welche Menschen spielen in Ihren Werken eine Rolle?
In Ludwigshafen habe ich bei der Rheinpfalz gearbeitet und dort Leute kennengelernt, die mich beeindruckt haben. Das waren sehr zerrissene Figuren, auch hoffnungslos, heimatlos, die waren alle zerstört wegen irgendetwas. Sie hatten das aber authentisch verarbeitet.
Im Vergleich zu ihren Werken, die oft humorvolle Alltagssituationen schildern, scheinen diese Eindrücke aber widersprüchlich bedrückend?
Eine Erfahrung kann zwar selbst negativ sein, aber durch Bearbeitung bekommt sie dann eine andere Form.
Wie sind Sie zum literarischen Schreiben gekommen?
Es gibt einen Erstlingsroman, den ich mit 21 Jahren „verbraten“ habe. Es war eine bittere Klage über meine Eltern, meine Heimat und eine nicht besonders angenehme Jugend. Das war der Motor fürs Schreiben.
2004 wurden Sie mit dem Büchner-Preis ausgezeichnet. War schon Ihr erstes Werk ein literarischer Erfolg?
Gottseidank nicht, es ist sang- und klanglos untergegangen. Es gab nicht eine Rezension. Danach hatte ich ein totales Blackout. Ich glaube, ich habe gemerkt, dass ich zu jung war für alles. Erfahrung, Abstand, alles hat mir gefehlt. Der Erfolg kam dementsprechend auch erst mit meinem Buch 12 Jahre später.
Dann kamen die „Abschaffel“-Romane.
So wurden die Gewerkschaften auf mich aufmerksam. Einige meinten: Das können wir unseren Gewerkschaftsmitgliedern nicht vorsetzen. „Abschaffel“, das ist so eine trübe Tasse! Grauenvoll! Das passte nicht ins Bild eines Gewerkschafters. Das Problem für die Gewerkschaften war, dass es nur Arbeiterliteratur gab. Es gab aber prozentual gesehen erheblich mehr Angestellte als Arbeiter. Der Angestelltenautor, das war dann ich.
Wie kamen Sie zum Satireblatt Pardon?
Ich habe einen Text auf eigene Faust geschrieben – und Pardon hat den sofort gedruckt. Sie fragten nach meinem Alter – 27 – und sagten: „Dann kommen Sie!“
In Ihrer Vorlesung der Heidelberger Poetikdozentur haben Sie den Künstlertypen beschrieben, der außerhalb der Gesellschaft steht, und nach Formen sucht, um sich die Gesellschaft zu erklären. Entspricht das Ihrem eigenen Typ?
Ich hatte oft die Vorstellung, verheimlichen zu müssen, dass ich ein ganz empfindlicher Mensch bin. Die Poetik hat mich geschützt, da ich mir immer sagen konnte, dass das von den anderen Menschen nicht fassbar ist.
Ist Poetik für Sie auch eine Form von Widerstand?
Das habe ich als junger Mensch geglaubt. Aber das ist vorbei. Das ist Romantik. Wenn man Novalis liest, dann kommt man auf so etwas.
Warum halten Sie Kunst dennoch für lebensnotwendig?
Kunst ist nicht notwendig für die Gesellschaft. Das würde heute niemand mehr denken. Das ist nur etwas fürs Individuum. Wenn das Individuum merkt, das Gegebene ist für mich nicht ausreichend. Die von der Gesellschaft am stärksten gebeutelten Individuen, die findet man in der Literatur, in der Kunst oder in der Musik. Wenn die eine Bruckner- Sinfonie hören, dann können die ihr reales Leben für einen Moment ausblenden. Mehr ist aber nicht drin. Das ist der poetische Schein.
Was würden Sie einem jungen Schriftsteller raten?
Einem 20-Jährigen würde ich sagen: Sie sind einfach für jede Prognose zu jung. Schreiben Sie noch ein Buch, 15 Gedichte, lesen Sie viel, ermüden Sie nicht. Ich würde ihm ein gewisses Mönchtum raten. Und nicht wieder gleich ein Opus an den Suhrkamp Verlag schicken. Sondern schicken Sie einen kurzen Text an eine literarische Zeitschrift. Dann wird der Text entweder gedruckt oder die Zeitschriften lassen nie etwas von sich hören. Das heißt nur: Weiterarbeiten. Das ist das einzige, was man machen kann, wenn man jung ist.
Das Gespräch führten Janina Schuhmacher und Johanna Mitzschke