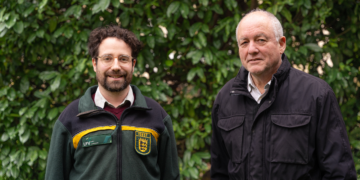Wissenschaftler aus Heidelberg beschäftigen sich mit den ungelösten Fragen ihres Fachs – Teil 2 der Serie.
[box type=“shadow“ ]

Die provokative These der deutschen Hirnforscher Roth, Singer, Prinz und Markowitsch, Willensfreiheit sei Illusion und deshalb ein auf ihr aufbauendes Schuldstrafrecht obsolet, ist zwar nicht mehr – wie im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts – aufgeregtes Thema der Feuilletons der großen Zeitungen, als Stachel im Lebensnerv des Rechts, aber nicht deshalb „erledigt“. Dass es Willensfreiheit nicht gibt, ist eine uralte philosophische These, gegen die sich das Strafrecht seit langem verwahren oder mit der es leben musste. Das Neue an der neurowissenschaftlichen Attacke ist deshalb nicht die Leugnung der Willensfreiheit, sondern die Behauptung, Willensfreiheit sei durch die Hirnforschung empirisch widerlegt, Anders-Entscheiden und Anders-Handeln-Können als Kern des Schuldvorwurfs folglich eine reine Fiktion, eine agnostische Einstellung zum Determinismus-Indeterminismus-Streit überholt. Das von den genannten Hirnforschern in seinem Ausmaß nicht erkannte zerstörerische Potential dieser These liegt darin, dass die Möglichkeit freier Willensbestimmung als Grundpfeiler allen Rechts keineswegs nur den Schuldvorwurf, sondern viele andere Institutionen des (Straf)Rechts (die Handlungslehre, die Freiwilligkeit beim Rücktritt etc.) und im Übrigen natürlich nicht nur das Strafrecht, sondern das Menschenbild der Verfassung und – in vielen Vorschriften expressis verbis – auch das Zivilrecht (z.B. §§ 104, 827, 1304 BGB) und das öffentliche Recht trägt. Wer Willensfreiheit daher für empirisch nachgewiesen widerlegt erklärt, reißt die Grundfesten jeden freiheitlichen Rechtssystems ein. Soweit sich Rechtswissenschaftler mit dieser neuen Qualität der Attacke auseinandersetzen, teilen sie sich in drei Lager. Die einen mahnen eine Neurojurisprudenz an, die sich auf den illusionären Charakter der Willensfreiheit einläßt und einen Umbau des (Straf)Rechts verlangt. Andere erklären das Recht und die Rechtswissenschaft in ihrem Freiheitsverständnis für autonom und behaupten deshalb, sie seien gegen die Attacke immun, anders ausgedrückt, die „Herausforderung“ gehe das Recht gar nichts an. Dritte verteidigen die Freiheitsannahme, weil der empirische Gegenbeweis weder schon da noch überhaupt führbar sei und werfen den Hirnforschern mit ihrem Übersprung vom Forscher zum Deuter einen Kategorienfehler vor. Die Gerichte ignorieren den neuerlichen Streit leider ganz. Die augenblickliche Situation ist folglich unbefriedigend. Die Jurisprudenz ist und bleibt meines Erachtens aufgerufen, sich an dem schon im Manifest elf deutscher Hirnforscher 2004 angeregten und von 15 Hirnforschern 2014 in ihrem deutlich moderateren Memorandum „Reflexive Neurowissenschaft“ neu angemahnten interdisziplinären Diskurs über das „neue Menschenbild“ und die Aussagekraft der Ergebnisse der neueren Hirnforschung für das Recht zu beteiligen, um die elementare Bedeutung der Freiheitsannahme für das Recht ins Bewusstsein zu heben und auch zu verdeutlichen, welche Art Freiheit das Recht „braucht“. [/box]
[box type=“shadow“ ]

Die großen ungelösten Fragen der Volkswirtschaftslehre sind leider meist nicht so präzise gestellt wie in der Mathematik. Wie schön wäre es, wenn man Fragen wie „Vernichtet ein Mindestlohn Arbeitsplätze?“ mit einem knappen mathematischen Beweis und einem „q.e.d.“ ein für allemal beantworten könnte. Aber von jedem vernünftigen Ökonomen werden Sie dazu zu Recht immer nur ein „Kommt drauf an …“ hören. In meinem Fachgebiet, der Spieltheorie, gibt es aber solche präzise Fragen. Die bekannteste betrifft Schach: Kann Weiß einen Sieg erzwingen? Oder Schwarz? Oder ist es immer unentschieden, wenn zwei optimale Strategien aufeinandertreffen? Schon lange ist bekannt, dass es eine dieser drei Möglichkeiten sein muss, da Schach ein endliches Spiel mit perfekter Information ist. Aber welche ist es? Im Prinzip könnte man einfach rückwärts arbeiten, von jedem beliebigen Ende aus. Das Problem ist, dass kein Computer der Welt diese vielen Möglichkeiten durchgehen kann. Und so wird es wohl noch ein Weilchen dauern, bis wir wissen, ob Weiß einen Sieg erzwingen kann. [/box]
[box type=“shadow“ ]

Ich sehe zwei große ungelöste Probleme, die nicht nur mein eigenes Fach, die Anglistik, sondern die gesamte Literaturwissenschaft betreffen. Das eine ist vermutlich unlösbar, das andere wird erst in einigen Jahren beantwortbar werden. Franco Moretti hat kürzlich darauf hingewiesen, dass wir eigentlich nicht in der Lage sind, Literaturgeschichte zu betreiben. Selbst hochspezialisierte Forscher können kaum mehr als 1000 dicke Romane des 19. Jahrhunderts lesen und im Kopf behalten; bei 60 000 alleine in Großbritannien damals veröffentlichten Texten ist das ein wenig aussagekräftiger Bruchteil, zumal es in der Praxis immer die- selben 100 Texte sind, die wir behandeln. Man macht es sich zu einfach, wenn man sagt: „Der Rest ist zu Recht vergessen.“ Das andere Problem zeichnet sich erst ab: jedes neue Medium, jedes neue Genre hat in der Vergangenheit schnell Meisterwerke hervorgebracht: es gibt großartige Filme aus dem frühen 20. Jahrhundert, die ersten Schauerromane gehören zu den Besten. Wo bleiben die großen Hypertextromane, Twittertexte, Facebook-Projekte, die digitalen Epen und multimedialen Sagas? Die Phänomene existieren, aber Breitenwirkung und Popularität erreichen nur Computerspiele. Kann das wirklich alles sein? [/box]
[box type=“shadow“ ]

Die Geschichtswissenschaft ist mit einer ganzen Menge ungelöster Fragen konfrontiert. Die wenigsten jener Probleme aber, die die Geschichtswissenschaft in einem größeren Maße umtreiben, werden sich überhaupt eindeutig lösen lassen. Als Kulturwissenschaft geht es der Geschichtswissenschaft nicht darum, allgemeingültige Lösungen oder Antworten zu erarbeiten. Seit langem ist sich das Fach der Perspektivenabhängigkeit historischer Erkenntnis bewusst. Wichtig ist daher nicht das Finden der einen „richtigen“ historischen Wahrheit (viele würden bestreiten, dass es so etwas überhaupt gibt), sondern die Suche nach und die Gegenüberstellung von möglichen Interpretationen der Geschichte. Daher prägen Debatten über die Interpretation historischer Phänomene und deren Einordnung in größere Bedeutungskontexte unsere Disziplin. Ein aktuelles Beispiel dafür sind die Auseinandersetzungen über die Ursachen für und die Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Die Debatte über diese Frage wogt spätestens seit Fritz Fischer in den 1950er- und 1960er-Jahren diesbezüglich eine klare Schuld der Deutschen ausgemacht hat. Diese Kontroverse hat im Jahr 2014 anlässlich des 100. Jahrestages des Kriegsausbruchs neuen Schwung aufgenommen. An ihr beteiligen sich mit ganz unterschiedlichen Interpretationen so namhafte Kollegen wie Christopher Clarke (Die Schlafwandler), Jörn Leonhard (Die Büchse der Pandora) oder Herfried Münkler (Der Große Krieg). Anhand der verschiedenen Standpunkte in der Debatte wird deutlich, dass unsere Interpretation der Vergangenheit immer in eine Vielzahl gegenwärtiger Befindlichkeiten eingebettet ist. So sagt zum Beispiel Münkler, dass Fischers These von der deutschen Kriegsschuld auch aus der Zeit ihrer Formulierung – also den 1950er- und 1960er-Jahren – heraus verstanden werden muss. Das bringt uns abschließend doch noch zum zentralen ungelösten Sachverhalt der Geschichtswissenschaft, nämlich der Tatsache, dass wir die Vergangenheit lediglich aus der Retrospektive betrachten können. Daher wird sie sich unserem Verständnis immer bis zu einem gewissen Grad entziehen und die Geschichtswissenschaft wird daher immer auch eine Gegenwartswissenschaft sein. Das kann man als Problem sehen – oder nicht. [/box]
Zusammengestellt von Valerie Meissner, Antonia Felber,
Tim Sommer, Kai Gräf, Monika Witzenberger und Dominik Waibel