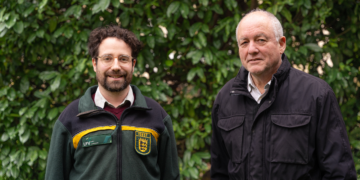Ein Praktikum in dem kleinen Land Ostafrikas bringt nicht nur Kenntnisse der Entwicklungszusammenarbeit, sondern vor allem ein Überdenken des Umgangs mit ökonomischen Privilegien.
„Muzungu, muzungu“, höre ich hinter mir, als ich auf meinem Weg zum UNESCO-Büro eine geteerte Avenue der burundischen Hauptstadt Bujumbura hinunterlaufe. Schon haben drei Kinder zu mir aufgeschlossen und fragen mich nach „Beignets“ (frittierte Teigbällchen) – häufig auch nach Geld. Muzungu bedeutet reicher weißer Mann und stammt aus der Kolonialzeit. In den meisten Ländern Ostafrikas werden weiße ausländische Angestellte, oder kurz Expats, mit diesem Begriff bezeichnet. In Burundi höre ich ihn täglich – ob als Spaß von meinem burundischen Chef oder Ansprache bei Verhandlungen um den Taxipreis. Natürlich werde ich damit erst einmal als reicher Europäer abgestempelt, obwohl ich in Europa als frischer B.A.-Absolvent alles andere als das bin. Gebe ich also 300 Burundi-Francs (ca. 0,15 Euro) für drei Beignets aus und bestätige damit diesen Stereotyp?
Tatsächlich beschreibt der Begriff einen Teil meines Lebens in Burundi sehr treffend. Ich wohne in einem reicheren Viertel und teile mir mit zwei weiteren Expats ein Haus mit kleinem Garten. Das Grundstück ist von einer hohen Mauer umgeben und wird von drei Security Guards im Schichtdienst bewacht. Am Wochenende gehe ich mit meinen europäischen Freunden oft in Restaurants, die leckere italienische Pizzen oder indische Curries anbieten. Wenn wir ab und zu Mal raus aus der Großstadt wollen, fahren wir am Wochenende an Strände außerhalb Bujumburas, wo schwimmen im Lac Tanganjika möglich ist. Das alles ist auch mit einem geringen Praktikumsgehalt durchaus möglich.
Das kann – und sollte – jedoch nicht die einzige Lebensrealität eines Expats sein, denn in einem der ärmsten Länder der Welt sind solche ökonomischen Privilegien die Ausnahme. Persönlich habe ich vorher in Deutschland nicht so gelebt und habe auch nicht den Anspruch, dies in Burundi zu tun. So besuche ich zum Mittagessen unter der Woche stets kleine burundische Restaurants, die große Portionen an Bohnen und Reis für weniger als einen Euro anbieten. Auch am Wochenende spielen meine Muzungu-Freunde und ich häufig Billard an Tischen mit anderen Burundiern und essen „Brochette“ (Fleischspieße) mit Kochbananen in lokalen Restaurants. Wenn wir an den Strand wollen, nehmen wir günstige Minibusse, die mit bis zu 23 Personen zentimetergenau gefüllt werden. Dass wir uns beispielsweise für burundische Verhältnisse teurere Restaurants gönnen, ist eher als Heimweh zu verstehen, statt den Anspruch zu haben, ständig ein „Muzungu-Leben“ in Burundi zu führen. Im Minibus und in den Restaurants sind wir allerdings häufig die einzigen Weißen.
Haben die Kinder auf der Straße also recht, wenn sie mich als Muzungu bezeichnen? Aus ihrer Perspektive sicherlich ja, wie ich jedoch in der Öffentlichkeit damit umgehe – sicherlich nicht. Trotzdem ist das „Muzungu-Sein“ nicht ausschließlich auf ökonomische Unterschiede beschränkt, sondern äußert sich ebenso gesellschaftlich und in persönlichen Beziehungen. Ist man nachts im Taxi unterwegs, muss man in Bujumbura stets an Polizeikontrollen vorbei. Zur Weiterfahrt muss eigentlich immer eine gewisse Summe bezahlt werden. Sitzen im Taxi jedoch Bazungu, geht die Kontrolle reibungsloser oder man wird erst gar nicht angehalten. Polizeigewalt an Weißen ist ebenso die Ausnahme.
Das sind nur einige Beispiele für gesellschaftliche Privilegien, die auf der Hautfarbe beruhen. Auch auf persönlicher Ebene hat dies Konsequenzen. Ich habe neben europäischen Freunden auch burundische Freunde. Der ökonomische Unterschied zwischen uns ist enorm. 82 Prozent der Burundier leben mit weniger als 1,25 US-Dollar am Tag und so verfügen auch meine Freunde nur über geringe finanzielle Mittel. Wenn wir zusammen ausgehen und mit meinen europäischen Freunden Zeit verbringen, zahle ich häufig die gesamte Rechnung sowie das Taxi. Dies sind für deutsche Maßstäbe günstige Preise, jedoch beschäftigt mich ständig die Frage nach der Gleichberechtigung in dieser Beziehung.
Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass diese aufgrund der Struktur der Weltwirtschaft nicht möglich ist. Hierfür können weder ich und schon gar nicht meine burundischen Freunde etwas. Dennoch belastet es Freundschaften und die Angst, man könnte nur Muzungu in den Augen des Anderen sein, ist eine Konstante.
Was mache ich also nun? Gebe ich den Kindern Geld, obwohl ich weiß, dass ich morgen in derselben Situation sein werde? Nein. Stattdessen kaufe ich den Kindern Beignets am nächsten Stand – heute.
Jeden Tag werde ich dies nicht so machen und nach einem freundlichen „Hallo! Wie geht es euch?“ weiterlaufen. Ich möchte nicht täglich einen Stereotyp bestätigen, mit dem ich mich nicht identifiziere – zumal ein Beignet keine nachhaltige Lösung ist. Geld gebe ich daher nicht. Die gesellschaftlichen und persönlichen Konsequenzen aber werden mich bis zum Ende meines Praktikums begleiten.
von Fabian Schuster