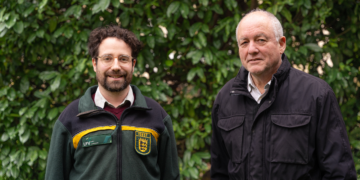Im Deutsch-Amerikanischen Institut herrschte am vergangenen Wochenende reges Kommen und Gehen, Austauschen und Lauschen, Diskutieren und Nachdenken – denn zu Gast war der Philosoph Peter Bieri, vielen bekannt als Bestsellerautor Pascal Mercier.
Der emeritierte Professor der Philosophie veröffentlichte unter seinem Pseudonym vier Romane, darunter den Bestseller „Nachtzug nach Lissabon“. In jüngeren Jahren verschlug es den gebürtigen Berner zu Studienzwecken nach Heidelberg. Nun kehrte er für ein dreitägiges Symposium in seine Studienstadt zurück. Aufmerksam, bedacht und erfrischend greifbar wendete er sich in Vorträgen, Lesungen und Diskussionen mit seinem Publikum Themen wie Würde, Freiheit, Philosophie, Bildung und Sprache.
Der rote Faden, der die Gedankenstränge des Symposiums und eben des Schaffens von Bieri verbindet, ist die Suche nach dem, was Peter Bieri als „eigene Stimme“ bezeichnet. Denn nur diese verleiht Authentizität. Und sie liegt in allen erdenklichen Bereichen:
[box type=“shadow“ ]Bildung: „Woher genau wissen wir das eigentlich?“
Weltorientierung, Aufklärung, Selbsterkenntnis – diese drei Schlagworte fügen den Bildungsbegriff des Philosophen und Autors Peter Bieri. Dort sitzt der belesene, weise, alte Mann am Rednertisch. Er spricht langsam, aber klar und bestimmt, als er darlegt, was er unter Bildung versteht und warum sie so wichtig ist.
Der allgemein anerkannte Bestandteil von Bildung ist die Weltorientierung, stellt er fest. Sie bedeutet nach Ansicht des Philosophen ein breites Verständnis davon, wie unterschiedlich es sein kann, ein menschliches Leben zu leben. „Das macht den gebildeten Menschen zum toleranten Menschen“, erklärt er. Man müsse die Zufälligkeit begreifen die dazu geführt hat, dass gerade man selbst gerade jetzt in gerade diesem Kulturkreis erwächst.
Aufklärung sei im nächsten Zug die Fähigkeit, Abstand zu dem zu gewinnen, was wir zu wissen glauben und zu fragen: Woher genau weiß ich das eigentlich und was bedeutet das? „Ich habe auf diese Weise früher Professoren in Verlegenheit gebracht, das sollten sie auch mal probieren. Fragen Sie einfach ‚Herr Professor, woher wissen Sie das?‘ Und Sie werden sehen, wie die Damen und Herren beim Antwortversuch ins Schlingern geraten!“, erzählt er augenzwinkernd, doch nicht ohne Ernst.
Nicht zuletzt erfordere Bildung Selbsterkenntnis. Das bedeutet, dass man sich eben nicht nur mit Informationen überschüttet, sondern bereit ist, über sich selbst nachzudenken, über sich selbst Bescheid wissen zu wollen. Welche Wege geht meine Phantasie? Welche Gefühle habe ich? Und wie kann ich das ausdrücken?
Bleibt jedoch die Frage, was Bildung nützt. „Schließlich“, sagt der Philosoph trocken, „standen im Land Schulen, Universitäten, Bibliotheken und was kam dabei raus? Auschwitz.“ Heinrich Himmler war Sohn des Rektors eines humanistischen Gymnasiums und auch Joseph Goebbels studierte, unter anderem an der Universität Heidelberg. Wie passt das mit Bildung zusammen?
Peter Bieri schließt daraus: „Die Bibliotheken allein nützen gar nichts. Das Lesen für sich genommen auch nicht. Sondern die Fähigkeit, sich durch das Gelesene verändern zu lassen.“ So wohne besonders dem Studium das Ziel inne herauszufinden, wer man wirklich ist und wer man werden will. Das sei zumindest zu seiner Studienzeit so gewesen, betont Bieri.
Der emeritierte Professor der Philosophie verabschiedete sich 2007 – mit der Bologna-Reform, wie er anmerkt – frühzeitig vom Universitätsbetrieb. Von seinem Bildungsbegriff findet er höchstens noch die Weltorientierung widergespiegelt. Dabei sei die Universität eine Institution von der man erwarten sollte, dass sie zeigt, dass sie vorlebt, auf welchen Wegen man Bildung erfahren kann. Na dann, unterbrechen wir doch gerne in Zukunft die Vorlesung mit der Frage: „Herr Professor, woher genau wissen Sie das eigentlich?“ Peter Bieri würde schmunzeln.
von Christina Deinsberger[/box]
[box type=“shadow“ ]Würde: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“
 Ein Dschungel von Fragen erwächst vor uns angesichts der Aufgabe, dieses Zitat zu verstehen. Peter Bieri bewahrt die Ruhe. Zwei Lesarten jenes fundamentalen ersten Satzes des ersten Grundgesetzartikels stellt er vor.
Ein Dschungel von Fragen erwächst vor uns angesichts der Aufgabe, dieses Zitat zu verstehen. Peter Bieri bewahrt die Ruhe. Zwei Lesarten jenes fundamentalen ersten Satzes des ersten Grundgesetzartikels stellt er vor.
Die erste: Die Würde des Menschen kann nicht angetastet werden. Voraussetzung dafür sei, dass die Würde als eine Eigenschaft gilt, die jedem Menschen gleichermaßen zukommt. Verliehen von einer höheren, normsetzenden, metaphysischen Instanz, wie ein Gott sie sein könnte.
Offen bleibt dann: Wieso noch verkünden, dass die Würde unantastbar sei, wenn sie doch eben genau das ist: Unantastbar? Unsere Intuition sagt hier etwas Gegenläufiges, nämlich, dass die Würde eine Größe ist, die auf vielfältige Weise nicht nur verletzt, sondern auch verspielt und zurückgewonnen werden kann.
Peter Bieri entwickelt seine Gedanken an einer zweiten Lesart: Die Würde kann verletzt werden, aber sie darf nicht verletzt werden. Er konzipiert die Würde als eine Art, zu leben. Die normsetzende Quelle ist dann eine andere: Der Mensch selbst. Erst in diesem Sinne ist der Satz als ein Gesetz zu verstehen.
Kein alltägliches Gesetz, denn da ist noch mehr: Ein „performativer Akt“. Ein Satz, der ein Ideal verkörpert, das erst, indem es in einem bestimmten institutionellen und historischen Rahmen platziert wird, als Orientierungspunkt anerkannt wird. Vielleicht auch im Sinne eines Bekenntnisses. Mit Sicherheit als ein Appell, der da zeigen will: „Wir haben aus der Geschichte gelernt.“
Doch wo steckt sie nun, die Würde? Bieri schöpft aus einem reichhaltigen Schatz an Beispielen, in denen man die Würde als etwas erfahren kann, das in Gefahr gerät – und das zugleich keinen anderen Namen kennt als eben den der „Würde“. Immer ist die Würde etwas Zwischenmenschliches, das, wenn es berührt wird, auf die Selbstbilder der Beteiligten zurückwirkt.
„Der Tod eines Handlungsreisenden“, ein Drama von Arthur Miller, liefert das Beispiel eines Angestellten, der seinen Vorgesetzten um Versetzung in den Innendienst bittet. Eine Situation, in der die Würde des Bittstellers erodiert. Denn das anfängliche Bitten wird rasch zum Betteln. Und Willy Loman, der Protagonist, zum Spielball seines Vorgesetzten. Denn er gibt offen seine Abhängigkeit zu erkennen und liefert sich der Willkür seines Vorgesetzten aus.
So dreht es sich bei der Würde immer auch um die menschliche Stimme. Die Fähigkeit, zu ihr zu finden und auch die Bereitschaft, sie zu hören: Die Geometrie der Begegnungen.
von Raphael Ostarek[/box]
[box type=“shadow“ ]Literatur: Ein Getriebener in Italien – der Schriftsteller Peter Bieri
Ein Zimmer in einem alten italienischen Landhaus. Toskana vielleicht. Großer Schreibtisch voll mit Blättern und Fotos. Und ein Mann, so um die Mitte vierzig, ein Getriebener. Seit 5 Uhr morgens schreibt er eine Seite nach der andern voll. Und nur der Hunger lässt ihn von Zeit zu Zeit innehalten. So muss man sich Pascal Mercier, alias Peter Bieri, bei der Entstehung seines ersten Romans „Perlmanns Schweigen“ vorstellen.
„Ich kenne keine intensivere Erfahrung der Gegenwart als das Schreiben einer Erzählung“, so der inzwischen ergraute Philosophenschriftsteller zu seinem Publikum. Als er damals ein Urlaubssemester nimmt, um in Italien ein neues wissenschaftliches Buch über Würde zu schreiben, kommt ein 640 Seiten Roman dabei heraus.
Bis zu jenem Tag hatte sich Peter Bieri eigentlich verboten selbst Prosa zu schaffen. Zu groß waren die Vorgaben von Literaturgiganten wie Thomas Mann, zu profund die Versagensängste, von denen er selbst sagt, dass er sie bis heute nicht ganz überwunden habe. Aber in diesen Monaten in Italien, beim Schreiben eines Romans, der sehr viel mit seinen eigenen Ängsten und Lebensthemen zu tun hat, erlebt Bieri das Wunder des „ganz nahe bei sich selbst seins.“ Und will mehr. „Meine Bücher sind nicht autobiografisch, aber sie sind authentisch“, meint Bieri.
Auch deshalb entscheidet er sich zunächst für das Pseudonym Pascal Mercier, das er erst nach Fertigstellung seines zweiten Romans ablegt. Er war noch nicht bereit dazu mit seinem Namen hinter diesem Werk zu stehen.
Als Quellen seines Schreibens nennt er primär biografische Erinnerungen – Schreiben um einschneidende Erfahrungen zu verarbeiten – und Tagträume, denn der Schriftsteller sei “ein geübter Tagträumer“. Mit dem Laufe der Zeit hat er sich auch praxisorientiertere Methoden zugelegt.
Beispielsweise sucht er sich passende Fotos für seine Romanfiguren, die ihn dann auf seinem Schreibtisch über den ganzen Schreibprozess hinweg als Vorlage dienen und er hat eine rote und eine schwarze Liste. Eine für Wörter, die ihm nicht selbstverständlich zur Verfügung stehen, die er aber potentiell verwenden will (rot) und eine andere für Wörter, zu denen er zwar neigt, die aber in diese Erzählung nicht passen (schwarz). „Sie bringen sich selber zur Sprache indem sie eine Geschichte schreiben“, sagt Peter Bieri und eine neue Ernsthaftigkeit liegt in seiner Gestik.
Einmal auf den Geschmack gekommen, will man nichts mehr anderes tun, ist er überzeugt. Würde er auch ohne seinen doch sehr beachtlichen literarischen Erfolg weiterschreiben? Vermutlich ja. Denn frei nach Martin Walser: „Es kommt nicht darauf an, etwas geschrieben zu haben, sondern etwas zu schreiben.“
von Dorina Marlen Heller[/box]