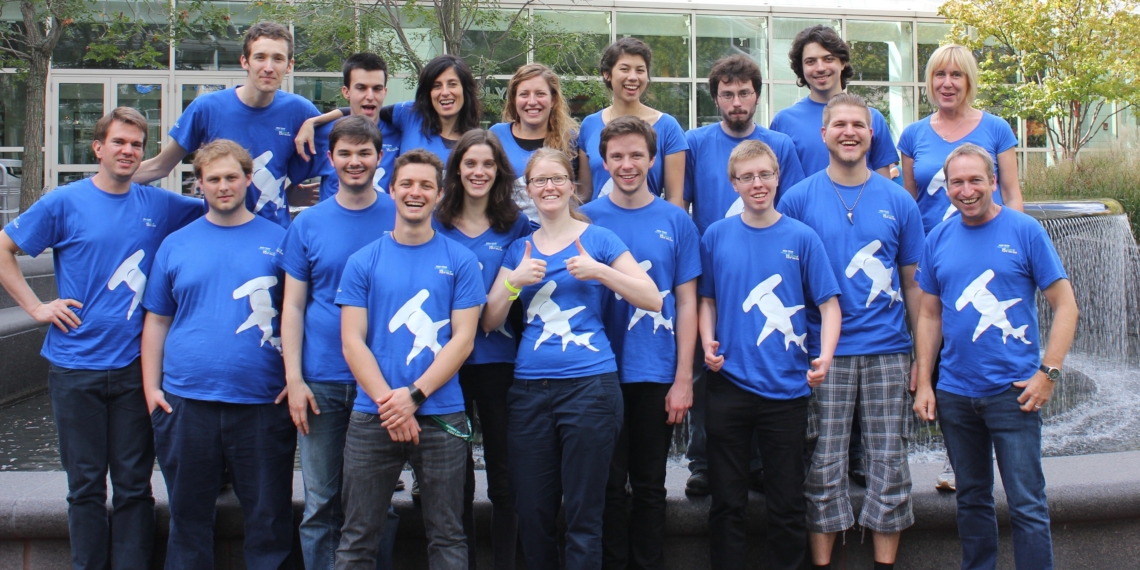Heidelberger Team konnte erneut bei dem renommierten iGEM-Wettbewerb überzeugen.
Zum wiederholten Mal konnte das Team der Heidelberger Universität bei „iGEM“ ins Finale einziehen. Bei dem Wettbewerb für Synthetische Biologie treten Studententeams gegeneinander an und stellen ihre Versuchsreihen und Projektideen vor. Die besten Teilnehmer stehen dann im Finale, das in Boston abgehalten wird.
2014 und 2013 konnte das Heidelberger Team jeweils den „Grand Prize“ gewinnen, somit ist der Finaleinzug 2015 schon der dritte Erfolg hintereinander für die Jungforscher. Sie konnten am „Giant Jamboree“ in Boston diesmal den dritten Platz belegen.
Wir haben mit Jasmin und Frieda vom Heidelberger iGEM-Team über ihre Erfahrungen und Erfolgsrezepte gesprochen.
Was genau ist der iGEM Wettbewerb?
iGEM ist ein internationaler Wettbewerb für Studenten auf dem Fachgebiet der Synthetischen Biologie. An vielen Unis weltweit werden Teams gebildet, die dann gegeneinander antreten. Sie entwerfen ein Forschungsprojekt, suchen Sponsoren, planen und führen Experimente durch. Es gibt dann Preise in verschiedenen Kategorien. Dieses Jahr haben 280 Teams von vier Kontinenten teilgenommen. Unser Team besteht aus Studierenden der molekularen Biotechnologie und der Biowissenschaften.
Für Laien: Wie sah euer Beitrag aus?
Wir haben mit funktionalen Nukleinsäuren gearbeitet. DNA ist wohl die bekannteste Art von Nukleinsäuren und den meisten Leuten als biologischer Informationsspeicher ein Begriff: Sie wird von den Eltern an ihre Kinder weitergegeben und bestimmt beispielsweise welches Geschlecht wir haben oder welche Augenfarbe. Neben DNA gibt es aber noch viele weitere Arten: Wissenschaftler konnten Nukleinsäuren synthetisieren, die keine solchen Informationen enthalten, sondern Reaktionen katalysieren oder an Moleküle binden. Im zweiten Fall spricht man von Aptameren. Diese speziellen Nukleinsäuren haben wir für verschiedenen Anwendungen genutzt, unter anderem um K.O.-Tropfen in Getränken nachzuweisen, aber auch für medizinischen Fragestellungen oder Laboranwendungen.
Das klingt spannend! Welcher Zusammenhang besteht denn zwischen Aptameren und K.O.-Tropfen?
Aptamere sind kurze DNA-Stränge, die kleine Moleküle binden können. Wir haben die Software „MAWS“ entwickelt, mit deren Hilfe man die Sequenz von Aptameren vorhersagen kann, um sie dann im Labor zu testen. Mit „MAWS“ konnten wir verschiedene Aptamere finden. Unter anderem konnten wir ein Aptamer für Ketamin, das in K.O.-Tropfen als Wirkstoff verwendet wird, berechnen. Das haben wir dann im Labor erzeugt. Verknüpft mit einem „Readout-Modul“ können wir es zu Drinks hinzugeben. Wenn in dem Getränk Ketamin, also der Wirkstoff von K.O.-Tropfen, enthalten ist, erkennt man das an einer Verfärbung der Flüssigkeit. Diese Verfärbung entsteht, weil unser Aptamer an das Ketamin-Molekül bindet. Es war uns wichtig, dass unser Projekt nicht nur für die Wissenschaft relevant ist, sondern auch einen alltäglicheren Nutzen von synthetischer Biologie zeigt.
Wie viel Arbeit habt ihr in euer Projekt investiert?
Von Juni bis Mitte September haben wir kontinuierlich im Labor gearbeitet. Davor mussten wir unser Projekt aber erst einmal planen und uns um die Finanzierung kümmern. Am Ende wurde es schon sehr stressig, aber das fiel zum Glück in die vorlesungsfreie Zeit. Auf jeden Fall kann man sagen, dass wir in Sachen Zeitmanagement viel dazugelernt haben: Die Tage und Nächte, die wir im Labor verbracht haben, waren doch öfter einmal sehr lang.
Werdet ihr in Zukunft weiter daran arbeiten, oder ist eure Forschung mit Ende des Wettbewerbs auch vorbei?
Nein, unsere Forschung hört nicht mit dem Wettbewerb auf. Wir arbeiten bereits an einigen Unterprojekten weiter, die aus unserem iGEM-Beitrag hervorgegangen sind. Wie das K.O.-Tropfen-Beispiel zeigt, ist unsere Forschung ja auch außerhalb des iGEM-Wettbewerbs sinnvoll und relevant. Wir denken, dass in unseren Ideen großes Potential steckt. Wir bereiten jetzt die Veröffentlichung unserer Ergebnisse in einem Fachjournal vor, um sie so der wissenschaftlichen Community vorzustellen und zugänglich zu machen.
Ist iGEM für euch denn eher Vergnügen oder hilft es euch, sich auf den späteren Beruf vorzubereiten?
Zum Glück beides! Ich denke, dass iGEM sehr viel näher an der Arbeit eines Wissenschaftlers ist als es Vorlesungen und andereVeranstaltungen im Rahmen des Studiums sind. Neben der Wissenschaft haben wir aber auch Teamarbeit und Ergebnispräsentation geschult. Mir hat iGEM besonders gefallen, weil man ein Forschungsprojekt von Anfang bis Ende kreiert. Kaum irgendwo anders hast du als Student die Möglichkeit, neue Forschungsideen so frei zu entwickeln und zu testen. Es war mir aber auch immer wichtig, dass die Arbeit Spaß macht, nur dann lohnt sich der große Einsatz am Ende wirklich.
Schon zum dritten Mal in Folge war das Heidelberger Team bei iGEM erfolgreich. Was für Gründe seht ihr dafür?
Einen Vorteil hatten wir dadurch, dass wir unser Thema sehr bewusst gewählt haben. Das hat uns viel Zeit gekostet, ebenso wie die ausführliche Planung unserer Experimente. Aber das war wichtig, damit sie eine gewisse Aussagekraft enthalten und auch reproduzierbar sind. Einen weiteren Vorteil sehen wir in der guten Infrastruktur, die wir hier nutzen konnten.
Wir haben unseren Wettbewerbsbeitrag im modernen „BioQuant“-Institut geplant und vorbereitet. Außerdem haben wir mit der Dietmar Hopp Stiftung, der Klaus Tschira Stiftung, dem DKFZ und einigen weiteren Unterstützern auch finanziell großen Rückhalt bekommen. Dieser Hilfe ist es auch zu verdanken, dass alle Teammitglieder mit nach Boston reisen konnten.
Außerdem konnten wir immer auf den guten Rat unseres Betreuerteams um Roland Eils, Irina Lehmann und Barbara Di Ventura zählen. Aber natürlich spielt auch das Team als solches eine große Rolle: Wir haben uns gut verstanden und konnten uns aufeinander verlassen, sodass der gemeinsame Trip nach Boston und das Finale viel Spaß gemacht haben.
Das Gespräch führte Johanna Famulok.