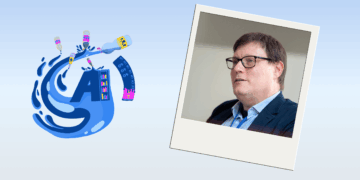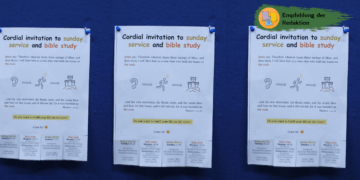Interview mit Reinhold Messner, dem berühmtesten Bergsteiger Deutschlands, wenn nicht der Welt. Dessen ist er sich bewusst. Als Jugendlicher war er einer der besten Kletterer der Alpen, mit 26 bestieg er den Nanga Parbat, einen der schwierigsten Achttausender der Welt, durch die höchste Steilwand der Erde. Dies galt bis dahin als unmöglich. Dabei verlor er seinen Bruder und sieben Zehen. Dann bestieg er alle anderen Achttausender ohne Flaschensauerstoff, auch das galt als unmöglich. Er lief zum Südpol, durchquerte Grönland und die Wüste Gobi. Für fünf Jahre saß er für die Grünen im Europäischen Parlament. Seit 2003 hat er schon das sechste Messner Mountain Museum gegründet, diese behandeln verschiedene Themen um die Berge und den Alpinismus.
Er trägt wallendes Haar, mit 71 Jahren wirkt er jugendlicher als viele Studenten. Messner begrüßt uns mit dem Satz: „Studenten, die sind langweilig. Ihr habt fünf Minuten“.
Herr Messner, Sie waren auf allen 14 Bergen mit über 8000 Metern Höhe, sind zum Südpol gelaufen. Wie überlebt man das?
Das hängt zuerst einmal mit den eigenen Fähigkeiten zusammen, man muss ein Leben lang lernen. Und zweitens: Immer wenn ich merkte, dass eine bestimmte Tätigkeit nicht mehr möglich ist, bin ich auf eine andere umgestiegen. Bisher habe ich sechs Leben geführt: Ich war Felskletterer, ich war Höhenbergsteiger, ich war Grenzgänger, ich war Forscher, ich war Politiker und gerade bin ich Museumsgestalter.
Wie haben Sie gemerkt, dass ein Abschnitt zu Ende ist?
Beim Felsklettern ganz einfach: Weil ich mir die Füße abgefroren hatte und mir die Zehen amputiert wurden. Dann konnte ich nicht mehr so gut klettern. Und beim Bergsteigen wollte ich mich nicht wiederholen. Als ich alleine auf den Everest stieg, war mir klar: Höher geht es nicht. Dann hab ich umgesattelt und bin durch die Wüsten gelaufen. Und dann habe ich mir das Fersenbein zertrümmert, danach konnte ich nur noch kleine Abenteuer machen.
Wann haben Sie gemerkt, dass sie zum Klettern und Bergsteigen berufen sind?
Ich bin nicht zum Klettern und Bergsteigen prädestiniert. Das ist ein reiner Zufall, weil ich in einem Dolomitental groß geworden bin. Da war alles sehr eng, auch die Vorstellung der Entscheidungsträger. Also, eng im mittelalterlichen Sinne und natürlich auch im geographischen Sinne. Und durch das Hinaufsteigen auf diese Berge, die am oberen Rande dieses Tal umstellt haben, ist mir klar geworden, dass diese Welt größer ist. Ich bin mit fünf Jahren auf meinen ersten 3000er mitgenommen worden und so habe ich das eben angefangen – auch aus Ermangelung anderer Möglichkeiten, mich auszutoben. Daher bin ich Bergsteiger geworden.
Was haben Sie in Ihren Karrieren über das Leben gelernt?
Auf jeden Fall habe ich in der Wildnis mehr gelernt als in der Schule! Und darüber kann ich nicht sprechen, ich habe darüber ein Buch geschrieben. Diese Frage dürfen Sie nicht stellen!
Welche Herausforderungen gibt es noch für Alpinisten?
Das ist eine ganz interessante Frage. Die gibt es immer noch! Was die vorherige Generation als unmöglich erklärt hat, will die neue Generation machen. Dabei ging es nie um richtig oder falsch – das Abenteuer braucht keine Rechtfertigung – sondern nur um möglich oder unmöglich. Diejenigen, die das hinterfragen sind die Pioniere, die machen das Unmögliche möglich und wenn es für Einen möglich ist, wird es für die ganze Welt früher oder später möglich. Das Bergsteigen jedoch hat sich immer mehr zu einem Spiel gewandelt.
Sind die Berge zu einem großen Abenteuerspielplatz geworden?
Das meine ich nicht, einige Engländer behaupteten das bereits seit 1865. Ein Abenteuerspielplatz kann es nur sein, wenn man alles in Ketten und Seile legt. Sonst ist es eine ernste Angelegenheit. Das heißt: Ich lebe wie der Mensch vor 100.000 Jahren. Da hatte er auch keine Sicherheiten, da kam ein Löwe und hat ihn einfach gefressen. Wir laufen durch die Stadt und uns ist bewusst: Die Ziegel fallen uns nicht vom Dach auf den Kopf! Und bis vor 20 Jahren war die Gefahr, dass jemand neben mir einen Sprengsatz zündet, relativ gering. Jetzt ist die Gefahr relativ größer geworden.
Gibt es noch Pioniere?
Ja, es gibt noch genug Wände im Himalaya, die von allen Jungen beäugt werden. Eine besonders. Alle sind bisher an ihr gescheitert. Die ist sehr steil, wird oben noch steiler und ist sehr gefährlich. Und wenn man oben ist, muss man noch runter kommen. Der Berg ist immerhin 7800 Meter hoch. Aber wenn es jemand schafft und sie das einen normalen Journalisten erzählen, sagt der: Was ist das denn? Der ist ja nicht einmal 8000 Meter hoch. Es ist ein Klischee entstanden, dass nur die 8000er etwas Großes bieten. Die Jungen haben es schwierig, weil ihre Geschichten viel schwieriger einem breiten Publikum beizubringen sind.
Aber durch die Sozialen Medien doch auch deutlich einfacher?
Dadurch bin ich ja ein Pionier geworden. Ich erzähle ihnen eine Geschichte: Robert Falcon Scott ist 1910 von England in die Antarktis aufgebrochen. Dort hat er den Winter verbracht und ist dann zum Südpol gelaufen, er hat diesen im Januar 1912 erreicht. Dann ist er verschwunden, gestorben. Aber man wusste das nicht, er ist nur nicht zurückgekommen. Man hat ihn im November 1912 gefunden. Und ein Jahr später erfuhr es die Welt, durch sein Tagebuch. Dieses Tagebuch ist heute noch ein Bestseller.
Wer heute hingegen ein Foto postet, ist morgen vergessen. Wenn ich das Abenteuer erlebt habe, muss ich auch fähig sein, diese Geschichte zu erzählen.
Diese großartigen Kletterer heute haben es viel schwerer, ihre Geschichten an den Mann zu bringen. Weil es so schnell geht. Weil es so oberflächlich ist. Weil das nur ein Anstrich ist, auch für den Leser. Da sieht der Leser ein Gipfelbild und schon kommt der nächste Post. Ich verteidige die jungen Leute, ich verstehe, dass die es schwerer haben als ich.
Ich konnte meine ersten Expeditionen nicht finanzieren, sondern musste lernen, das durch das Geschichtenerzählen auf der Bühne oder in Büchern zu finanzieren.
Fünf Minuten sind vergangen, er macht keine Anstalten aufzustehen.
Sie hatten viel Einblick in verschiedene Kulturen und konnten beobachten, wie sich diese verändert haben. Erkennen Sie einen Wandel im Himalaya, zwischen ihrem ersten und letzten Besuch dort?
Das, was ich als Abenteuer oder als Grenzgang bezeichne, wird mehr und mehr zum Sport. Über neunzig Prozent der Kletterer klettern nur noch in der Halle. Das ist ein großartiger Sport, hat aber mit Alpinismus Null zu tun. Das ist nur übernommen: Es ist Klettern an der Plastikwand. Der Alpinismus ist ein Unterwegs-Sein in Eigenverantwortung, in Eigenregie, ich entscheide selbst. Es gibt keine Richter mehr, nur möglich und unmöglich. In einer großartigen und gefährlichen Welt. Wenn es nicht schwierig ist, ist es kein Grenzgang. In der Halle kann ich viel höhere Schwierigkeitsgrade klettern, weil ich ja runterspringen kann, ich bleibe im Seil hängen. Das wird auch ausgedehnt von der Halle an Felsen, da wird alles präpariert, genau wie in der Halle, alle zwei Meter ein Haken. Das ist das Sportklettern, das eine riesige Entwicklung hinter sich hat. Da gibt es inzwischen Leute, die klettern Sachen, das hätte ich nie geschafft.
Der andere Teil ist: Auf den großen Bergen wird es zum Tourismus. Da wird eine Infrastruktur gebaut. Sie brauchen Flughäfen, Straßen, Restaurants,… Das wird jetzt bis zum Gipfel des Everest verfolgt. Sie können den Everest buchen, ganz normal im Reisebüro. Die letzten Jahre waren 500 Sherpas vor Ort, zwei Monate lang, die eine Piste auf den Gipfel des Everest gebaut haben. Das kostet einige Millionen Dollar. Für bis zu 100.000 Dollar kann jetzt beinahe Jeder – betreut – auf den Everest laufen. Sie werden bloß noch nicht hoch getragen. Das ist nur eine Feststellung: Das ist Tourismus. Wenn der Tourismus nun den höchsten Gipfel der Welt erreicht hat, wo beginnt der Alpinismus?
Ja, wo beginnt er?
Dort wo die Welt ursprünglich geblieben ist. Wenn ich die Welt erschließe, dann ist der Alpinismus nicht mehr möglich. Der Alpinismus muss das Unmögliche mit einschließen. Nur wenn der Mensch heute freiwillig auf Technologie verzichtet, kann er weiterhin an die Grenze des Machbaren gehen. Wenn man alle Technologien einsetzt, kann man sich auf fast jeden Berg hinauffliegen lassen.
Definieren sie das Abenteuer also als rein physisch?
Nein, das Wort Abenteuer benutze ich nicht mehr gerne, weil jedes Reisebüro ihre Reisen als Abenteuer anbietet. Sogar ein Nationalpark in Kenia ist jetzt ein Abenteuer. Das ist natürlich ein gut organisierter Tourismus. Das darf auch sein. Ich kritisiere das nicht. Aber der Grenzgang ist nur möglich, wo es eine Grenze gibt. Die Grenze meines Könnens. Ich kann nur an meiner Grenze erfahren, wer ich bin. Es geht um archaische Erfahrungen. Diese Erfahrungen prägen sich stärker in unser Gedächtnis ein als ein Spaziergang durch den Stadtpark.
Was für eine Bedeutung hat Ihre Halskette für Sie?
Ich habe große Anerkennung für die tibetische Kultur. Das ist eine tibetische Kette, ein tibetischer Stein. Man weiß nicht genau, was er bedeutet, aber er hat einen großen Wert. Für die Tibeter ist es mehr als ein Talisman, mehr als ein Schmuckstück. Und wir vermuten heute, dass diese Steine – das sind Achate – in bestimmten Steinbrüchen gebrochen wurden und dass diese Steinbrüche verloren gegangen sind. Es gibt heute keine mehr, also es gibt nur alte Steine. Und Millionen von Fälschungen. Heute Abend sehe ich im Publikum mindestens zehn Fälschungen, weil die Leute das nachmachen. Aber mein Originalstein hat einen Wert von 10.000-15.000 Dollar. Früher dienten sie als Währung und die Augen die drauf zeigten den Wert an.
Die Mythologie dazu ist sehr interessant: Sie sagt, dass diese Steine als Würmer vom Himmel fallen und sie werden in Nestern im Boden gefunden. Das weist darauf hin, dass es früher Geldtaschen waren. Erst vor zwei Jahren habe ich eine Grabung miterlebt, wo jemand die Steine gefunden hat, in verschiedenen Größen, verschiedene wertvolle Steine.
Wieso hat denn Tibet so eine besondere Bedeutung für Sie?
Tibet hat eine ganz eigene Kultur. Eigenständig insofern, als dass dieses Land ja von den größten Bergen der Welt umstanden ist: Kaum jemand kam rein, kaum jemand kam raus. Und dann wurde es von den Chinesen besetzt, in den 50er Jahren. Seit dem hat man den Tibetern im Großen und Ganzen immer mehr Freiräume genommen. Die Bemühungen bisher, den Tibetern eine gewisse Autonomie zu erkämpfen, sind fehlgeschlagen. Ich habe es auch versucht, als ich in Brüssel im Parlament war – ohne Erfolg. Die Chinesen geben nicht nach. Aber der Dalai Lama versucht, diese Diskussion weiter am Leben zu halten, auch wenn er seine weltliche Macht abgegeben hat. Heute bin ich ein bisschen hoffnungsvoller als vor zehn Jahren oder vor zwanzig Jahren, weil die jungen Chinesen anfangen, sich für Tibet zu interessieren. Es gibt natürlich auch eine eigene tibetische Malerei und Bildhauerei. Dafür gab es in London und Zürich einen ganz guten Markt, weil die Engländer schon vor hundert Jahren in Asien waren und des Öfteren an den Rand des Himalaya kamen. Inzwischen ist dieser Markt in Asien. Wenn heute ein junger Chinese ein tibetisches Stück in einer Auktion haben will, kann er so viel Geld haben wie er will, er wird es nicht bekommen, keine Chance. Besser verzichtet er direkt darauf.
Und das ist ein Zeichen, dass diese Kultur plötzlich einen Wert bekommt. Und damit besteht die Hoffnung, wenn diese jungen Menschen früher oder später in der chinesischen Politik eine Rolle spielen – und einige werden eine Rolle spielen – dann wird man darüber nachdenken, dass es vielleicht doch schlauer ist, den Tibetern ihre Kultur, ihre Sprache, ihre Religion zu lassen, weil sie nur so auch einen touristischen Ausstrahlungswert haben. Und so kann Tibet auch selber ernährt werden, sie brauchen dann keine Hilfen. Im Moment werden die mit chinesischem Geld gefüttert. Das sind natürlich alles politische Erkenntnisse.
Möchten sie den jungen Leuten noch etwas ans Herz legen?
Also ich bin erstens kein Religionsstifter, das überlasse ich anderen. Ich habe keine Message. Ich bin generell der Meinung, das Wichtigste für junge Menschen ist, dass sie den Mut haben, ihren Weg zu gehen. Also, zu entscheiden, welchen Weg sie gehen. Dass sie auch bereit sind, des Öfteren im Leben umzusteigen. Der Mensch hat a priori keinen Beruf, so wie das Tier keinen Beruf hat und die Pflanze keinen Beruf hat. Natürlich brauche ich eine gute Ausbildung und je besser jemand ausgebildet ist und je mehr man Sprachen kennt und je weiter jemand die Welt angeschaut hat – ich meine jetzt auch unsere globalisierte Welt – umso leichter tut er oder sie sich, sich in dieser Welt zu positionieren. Aber das Leben anlegen, wie viele Mamas das möchten, dass der Sohn ein erfolgreiches, ein gelungenes Leben haben wird, das ist absolut falsch. Es gibt im Grunde kein gelungenes Leben, sondern es gibt nur, durch Versuch und Irrtum, ein gelingendes Leben, in dem man wagt, seine Ideen in die Tat umzusetzen. Und zwar, während ich es tue. Das nenne ich den goldenen Schritt: Aus einer Idee eine Tat zu machen. Und dabei entsteht, im Hier und Jetzt, ein gelingendes Leben. Das gelingt, indem ich es tue und nicht im Rückblick. Im Rückblick ist es völlig wurscht, was ich getan habe. Es ist auch völlig wurscht, wie viele Häuser ich habe und wie viel Geld ich verdient habe, aber? natürlich brauche ich auch Mittel. Zu jedem gelingenden Leben gehören auch Mittel. Aber ich bin ganz überzeugt davon, dass jedes gelingende Leben, das mit Begeisterung gelebt wird, die Mittel automatisch generiert. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Junge Menschen machen sich viel zu viele Sorgen.
Das Gespräch führten Dominik Waibel, Johanna Famulok, David Kirchgeßner