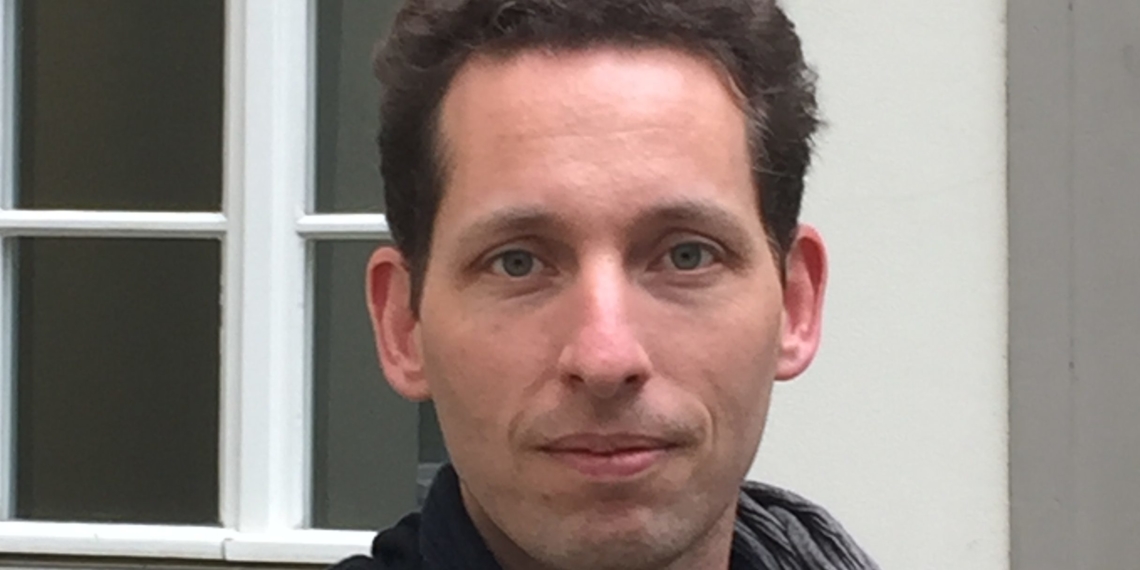Viel Geld, vermutlich auch für Heidelberg: Mit einer neuen Runde der Exzellenzinitiative wollen Bund und Länder deutsche Spitzenuniversitäten auch in den nächsten Jahren fördern. Doch ist es sinnvoll, die Initiative überhaupt weiterzuführen?
[dropcap]D[/dropcap]ie „Exzelleninitiative“, die nun als „Exzellenzstrategie“ verstetigt werden soll, verspricht einigen Akteuren viel Geld. Mit jährlich 533 Millionen Euro, die in einem Wettbewerbsverfahren verteilt werden, soll die Forschung in etwa 50 „Exzellenzclustern“ sowie an acht bis elf „Exzellenz-Universitäten“ gefördert werden. Das sieht nach großzügigen Zuschüssen aus.
Irritieren kann zunächst bloß, dass die Formel „Exzellenz“ alle Inhalte verdrängt und dass man sich von ihr eine „vertikale Differenzierung“ des deutschen Hochschulsystems erhofft, das heißt eine Unterscheidung von Oben und Unten. Sind bei der Exzellenzstrategie also vielleicht auch Verlierer eingeplant?
Es lohnt zu fragen, für wen die Exzellenzstrategie sinnvoll ist. Realistische Aussichten auf Exzellenzstatus können sich nicht viele Universitäten machen; schon die große, vielfältige Universität Hamburg hat so geringe Chancen, dass die dortige Landesregierung in letzter Minute die Wettbewerbsmodalitäten zu ändern versucht.
Wenn erst einmal die Standorte vermuteter Spitzenforschung ausgewählt sind, wird es für alle anderen wohl zunehmend schwierig, vergleichbare Leistungen zu ermöglichen und freie Forschungszeit einzuräumen.
Die Formel ,Exzellenz‘ verdrängt alle Inhalte und schafft eine Unterscheidung von Oben und Unten
Im Cluster-Wettbewerb werden mehr Bereiche eine reale Chance haben. Sie haben zwei Jahre Zeit zur Vorbereitung und werden von Hochschulleitungen und Landesregierungen kraftvoll unterstützt. Die sinnvollen Tätigkeiten vermehrt das jedoch nicht unbedingt.
Aussichtsreiche Bewerber werden bereits vor dem Wettbewerb auf Kosten anderer gefördert, inhaltlich stehen dabei offenkundig nicht die Ideen und Interessen der Forschenden selbst im Vordergrund, und formal müssen sie ihre Kraft in Anträge stecken, statt sich in Laboren, Bibliotheken, Archiven oder im Feld bewähren zu können.
Die Exzellenzstrategie fördert so eine vorauseilende Hierarchisierung zur Gestaltung einnehmender Forschungsfassaden. Die stiefmütterliche Behandlung der Lehre wird durch sie ohnehin befestigt. Vermittelt durch Rankings hat sich die Annahme durchgesetzt, dass die Universitäten erstklassig sind, an denen bekannte Forschende sitzen. Das steigert die Bewerbungszahlen bei Ranking- und Exzellenzsiegern – aber es gewährleistet keine hohe Studienqualität. Gerade Forschungsstars werden vielerorts von der Lehre befreit. Je größer die Namen sind, desto weniger bekommt man gewöhnlich von ihnen mit. An anderen Standorten muss sich das wissenschaftliche Personal dagegen zwischen Forschung und Lehre aufreiben und stößt regelmäßig an seine Kapazitätsgrenzen.
Die Liste der Hierarchisierungen ist länger. Die Kluft zwischen dem prekär beschäftigten Mittelbau und der professoralen Oberschicht vertieft sich durch den Exzellenzzwettbewerb oder wird neu geschlagen.
In der Wissenschaft wie bei den Studierenden gewinnt zudem die soziale Herkunft an Bedeutung, wenn sie exzellente Standorte ansteuern können. Allgemein lässt sich festhalten, dass ein Spiel mit wenigen Gewinnern und vielen Verlierern für die letzteren kaum sinnvoll ist – und auch die Privilegierten erleiden einen Verlust von Vielfalt und produktiver Spannung.
Sinnvoll ist die Exzellenzstrategie vor allem für eine Hochschulpolitik, die mit unwesentlich vermehrten Ausgaben besonders gut aussehen will.
Die Studierendenquoten sind in die Höhe geschossen, Studiengebühren wurden erfolgreich abgewehrt. Die Kosten wurden bisher in immer schlechtere Betreuungsverhältnisse ausgelagert, zu deren Bewältigung vor allem das wissenschaftliche Personal unterhalb der Professur ausgebeutet wird.
Die Exzellenzstrategie schafft hier keine Abhilfe, vermittelt aber ein anderes Bild: Während faktisch in der Breite gespart wird, demonstriert man, dass man die Spitze stärkt. Die Hochschulen sollten endlich beginnen, dagegen eigene Ziele ins Feld zu führen.