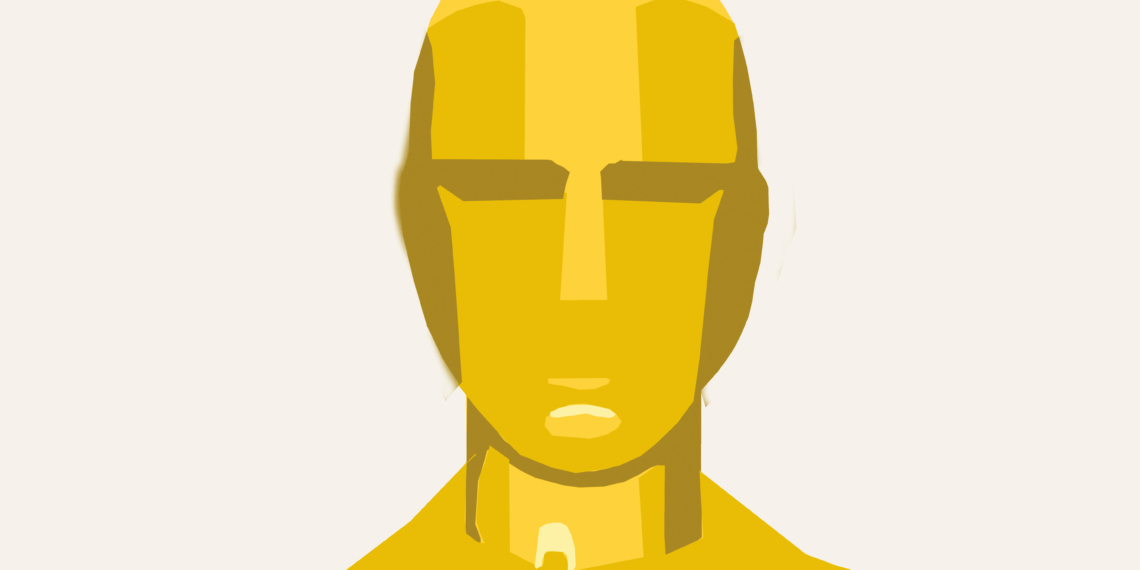[dropcap]A[/dropcap]ls ich am Morgen des 19. Oktobers aufwache, merke ich sofort, dass etwas nicht stimmt: Die Luft ist kühler, meine Umwelt verschwommener, die Stimmung ungewöhnlich ruhig. Es scheint wie die Stille nach einem Erdbeben, wie das verwirrte Aufwachen auf einem Trümmerhaufen. Wir schreiben das Jahr 2015. Der lang ersehnte Trailer des neuen Star Wars-Films feiert seine Premiere. Ein Stormtrooper nimmt seinen Helm ab: Doch – Gott stehe mir bei – er ist schwarz.
Absurd und doch real: Für die Verfasser des Hashtags „BoycottStarWarsVII“ auf Twitter lag der Grund der bevorstehenden Apokalypse auf der Hand. In einem fiktiven Universum voller Aliens, Jedis und Robotern hat der Einsatz von weiblichen und dunkelhäutigen Hauptdarstellern die Grenze des Möglichen überschritten. „Boycott Star Wars VII because it’s anti-white propaganda promoting #whitegenocide“, schreibt ein User auf der Plattform. Neben lautstarker Euphorie für den Film scheint diese Aussage in seiner Radikalität ein Einzelfall zu sein.
Schließlich leben wir im 21. Jahrhundert, dem Zeitalter der Globalisierung. Unser Staatsoberhaupt ist weiblich, der Vater des gewählten US-Präsidenten Kenianer und „Brangelinas“ Kinder so kulturell divers wie eine UN-Versammlung. Und doch erinnert nicht zuletzt die #OscarsSoWhite-Debatte daran, dass die Repräsentation von Minderheiten zwar in jeder künstlerischen Industrie ein Problem darstellt, Hollywood jedoch durch eine so offensichtliche Abwesenheit von Diversität besonders heraussticht.
Der Hashtag machte Anfang des Jahres darauf aufmerksam, dass die Academy zum zweiten Jahr in Folge keinen einzigen nicht-weißen Schauspieler für einen Oscar nominierte. Kulturell facettenreiche Besetzungen wie „Straight Outta Compton“ oder „Creed“, die schon lange vor der Preisverleihung als Favoriten galten, wurden letztlich komplett ignoriert; ihr Facettenreichtum dadurch gefeiert, dass die Auszeichnung in die Hände der einzigen weißen Mitwirkenden gelangte.
Das Event ist aber nur Symptom einer viel ernsthafteren Krankheit. In Ermangelung eines Megafons schreie ich es einfach mal aufs Papier: Die Protagonisten einer erfolgreichen Filmproduktion sind fast ausschließlich weiß, heterosexuell und männlich. Und das ist ein Problem.
Bevor die ersten Drohungen an mich und meine Familie formuliert werden, bestreite ich die totale Existenz von Minderheiten in Film und Fernsehen natürlich nicht:
Das Problem ist nur, dass sich diese Konfrontationen meist auf den indischen IT-Spezialisten Ranjid beschränken, der neben witzigem Akzent vor laufender Kamera Kühe anbetet; den überzeugten Muslim Mohammed, der sich „Allahu Akbar!“ schreiend in die Luft sprengt und davor noch sein „9/11 was awesome“-Tattoo entblößt, oder die afroamerikanische Shaniqua, die in einer „Law & Order“-Folge als „Ghetto-Drogen-Dealerin Nr. 3“ gecastet wird.
Der Begriff „racial typecasting“ fasst das Problem in seiner Essenz zusammen: Der alleinige Gebrauch ethnischer Schauspieler zum Zwecke vorgefertigter Stereotypen ist ein Muster, das sich in fast jeder großen Produktion abzeichnen lässt. Mal ist es der einzige Schwarze, der im Horrorfilm zuerst dran glauben muss, mal der schwule beste Freund, der neben frechen Kommentaren der Protagonistin dabei hilft, das perfekte Kleid auszusuchen.
Nun mag der aufmerksam ignorante Serienschauer entgegenhalten, dass Minderheiten inzwischen durchaus ihren Weg in „atypische“ Rollen gefunden haben. Und da liegt er gar nicht mal so falsch: Kultserien wie „How to Get Away With Murder“ oder „Scandal“ legen Wert darauf, mit einem kulturell diversen Cast zu glänzen. Umso mehr beweist die Tatsache, dass man solche Beispiele an einer Hand abzählen kann, den rassistischen Status quo, dem sie versuchen entgegenzuwirken. Oder in anderen Worten: Wenn Du mir innerhalb der nächsten 30 Sekunden fünf dunkelhäutige Schauspieler nennen kannst, ohne Morgan Freeman, Samuel L. Jackson und „den einen Typ aus dem Mandela-Film“ aufzuzählen, erhältst Du den Oscar, den er für seine Rolle nicht bekommen hat.
Schließlich waren 2011 einer Studie der University of California zufolge nur 10,5 Prozent der Hauptrollen amerikanisch produzierter Filme an „People of Colour“ (PoC) vergeben; mit gerade mal 7,6 Prozent waren sie auch unter den Filmemachern schockierend unterrepräsentiert. Und das, obwohl 40 Prozent der US-Bevölkerung als kulturelle Minderheiten gefasst werden können, so auch 9,1 Millionen Bürger in Deutschland.
Auch nach der unwahrscheinlichen Vergabe einer Rolle werden sie nicht künstlerisch gewürdigt: Gerade mal sieben Prozent aller Oscars für den „Besten Hauptdarsteller“ wurden an afroamerikanische Schauspieler vergeben. Wohlgemerkt beträgt der zeitliche Abstand von der ersten zur zweiten Auszeichnung – von Sidney Poitier zu Denzel Washington – rund 40 Jahre. In Retrospektive hatte Halle Berry 2002 nicht Grund zum Weinen, weil sie das weibliche Äquivalent der Kategorie gewann, sondern eher, weil sie bis heute die einzige afroamerikanische Gewinnerin geblieben ist.
„Viele Verfechter argumentieren, dass Hollywood einfach keine guten Rollen für ethnische Schauspieler bietet“, berichtet ein Nachrichtensprecher auf Al Jazeera. Doch gerade dieses Argument ist so erschreckend: Es suggeriert deutlich, dass schon klare Vorstellungen der Fähigkeiten eines kubanischen oder algerischen Schauspielers gezeichnet werden, ohne ihn als Individuum zu sehen; dass der Darstellungspalette eines solchen Künstlers schon von Anfang an klare Grenzen gesetzt werden, damit sie in die richtige Schublade passt.
Die Auszeichnung von auf Minderheiten konzentrierten Filmen wie „Slumdog Millionaire“ oder „12 Years a Slave“ scheint unter diesem Licht gar grotesk. Es bestätigt erdrückende Barrieren und stellt sie als Vorzeigeschild gelungener Integration dar: In dem Moment, in dem diese Schauspieler als ethnisches „Symbol“ verarbeitet werden können und in vorgefertigte Rollenvorstellungen schlüpfen, verändert sich die Lage plötzlich; in dem Moment, in dem der Schwarze einen Sklaven und der Inder einen Jungen aus den Slums spielt, schenkt Dir Hollywood sein Interesse.
Oder zumindest die für die Filmindustrie repräsentative Elite – die prestigehafte „Academy“, deren vermeintliche Repräsentativität an eine texanische Versammlung der Republikaner erinnert: Satte 94 Prozent der wahlberechtigten Mitglieder sind weiß, 77 Prozent männlich, das Durchschnittsalter beträgt 62 Jahre. Dass der Hip-Hop-Film „Straight Outta Compton“ rund um die Musikgruppe „Niggas Wit‘ Attitudes“ nicht dem Geschmack des durchschnittlichen 62-jährigen weißen Mannes entspricht, hätte ich mit hundertprozentiger Sicherheit voraussagen können.

Selbstverständlich konditionieren gewisse Geschichten auch einen bestimmten ethnischen Hintergrund: Einen aus Ghana stammenden Darsteller als Adolf Hitler zu casten, könnte den ein oder anderen Zuschauer von der Handlung ablenken. Das sollte man zumindest meinen. „Ich bin dunkelhäutigen Menschen gegenüber absolut tolerant. Aber eine farbige Hermine passt einfach nicht zur Geschichte“, schreibt eine Userin auf Facebook, als bekanntgegeben wird, dass Noma Dumezweni die Rolle der Hermine Granger in der neuen Theateradaption von „Harry Potter“ spielen soll.
Doch genau das ist die innewohnende Paradoxie des „Wir-haben-keine-Rollen-für-euch“-Arguments, das das Ignorieren von Minderheiten in gewissen Rollen mit einem „Deplatziert“ rechtfertigt: Keiner will einen ghanaischen Hitler, denn Hitler war kein Ghanaer (was ihn sonst ja auch zu einem wirklich unangenehmen Nachbarn gemacht hätte). Und trotzdem scheint dieses Argument in umgekehrter Situation plötzlich jegliche Relevanz zu verlieren: So sehen wir in „Exodus“ den britischen Christian Bale und seinen australischen Kollegen Joel Edgerton in den Rollen der Ägypter Moses und Ramses – Ägypten, Du weißt schon, dieses Land in Afrika; oder die blauäugig blonde Emma Stone, die in „Aloha“ die Hawaiianerin Allison Ng portraitiert. Sogar bei der Darstellung Johnny Depps als Indianer in „The Lone Ranger“ reagieren wir nicht einmal mit einem Kopfschütteln. Wie willkürlich die Hautfarbe beim Casten eines Charakters sein kann, stellt gerade die Industrie unter Beweis, die mit Hautfarbe ausgrenzt. Hollywoods „Whitewashing“: Die Rollen sind da – der Wille, sie an Minderheiten zu vergeben, nicht.
Und dabei wäre dies auch für Produzenten profitabel: Dass „Cross-Race“-Casting kein Nischen-Produkt ist, stellte zuletzt auch Lin-Manuel Miranda in seinem Broadway Hip-Hop-Musical „Hamilton“ unter Beweis. Die Geschichte um den amerikanischen Gründervater Alexander Hamilton bedient sich eines kulturell diversen Casts, der mit jeglichen künstlerischen Normen bricht: Hier steht ein afroamerikanischer George Washington neben einem puerto-ricanischen John Laurens. „Wir alle wissen, wie die Gründerväter aussahen. Es braucht wirklich keine Recherchearbeit, es herauszufinden: Wir müssen einfach einen Blick in unseren Geldbeutel werfen“, erklärt Macher und Hauptdarsteller Miranda, dessen Eltern ebenfalls aus Puerto Rico stammen. „Rasse und Geschlecht sollte genauso berücksichtigt werden wie Körpergröße und Alter: Es ist lediglich ein Faktor.“ Dass sich dieser Faktor auszahlt, ist nicht bestreitbar: Bei den diesjährigen Tony-Awards sicherte sich das Musical ganze 11 Auszeichnungen; die Vorstellungen selbst sind schon lange ausverkauft– Premium-Tickets lassen sich ab einem stolzen Preis von 549 Dollar erwerben.
„Die können aber doch jemanden nicht nur casten, weil er schwarz ist“ ist ein Argument, das mir in Diskussionen während meiner Recherche oft begegnete. Anschließend richtete sich mein Kontrahent, selbsterklärter Feind der „political correctness“, für gewöhnlich stolz auf – sicher, dass er mir nun die Sprache verschlagen hat. Sicher, dass er sich nun wirklich eine „Make America White Again“-Kappe verdient hatte.
Oftmals blieb mir die Sprache tatsächlich im Halse stecken, denn letztlich suggeriert diese Äußerung doch nur Folgendes: Ohne auch nur eine Auswahl an Alternativen gesehen zu haben, wird eine gleiche oder sogar bessere Leistung eines PoC-Schauspielers im Vergleich zu einem weißen Schauspieler von vorneherein ausgeschlossen. Die Vorstellung, eine Hauptrolle mit einem ethnischen Darsteller zu besetzen, wird damit gleichgesetzt, sich mit Mittelmaß abzufinden.
Die wirklich zentrale Frage ist doch: Was ändert sich an Hermines Charakter, jetzt, wo sie eine andere Hautfarbe hat? Was ändert sich an ihren Gefühlen, ihrem Intellekt, ihrer Person? Inwiefern ist James Bond weniger smart und charmant, wenn er asiatischer Herkunft ist – oder gar eine Frau?
Selbstverständlich haben Filme wie „12 Years a Slave“ oder „Slumdog Millionaire“ eine große gesellschaftliche Bedeutung. Sie stehen für historische und kulturelle Aufarbeitung. Aber auch ihr Wert kann nur völlig glänzen, wenn sie im Kontext von Filmen stehen, die das reale Leben von People of Colour zeigen.
Wir leben im 21. Jahrhundert, dem Zeitalter der Globalisierung. Wir leben in einer Zeit, in der „der weiße Mann“ immer noch die privilegierteste Gruppe unserer Gesellschaft darstellt, nicht aber ihr Gesicht. Eine Sitcom über fünf heterosexuelle weiße New Yorker als repräsentatives Abbild ihrer Stadt zu zeigen, ist eine Lüge. Und zwar eine fatale.
Denn Kultur kreiert Assoziationen, Aushängeschilder und Stereotype. Einen arabisch-stämmigen Amerikaner nie als kitschigen „Love Interest“ in einem drittklassigen Jennifer Aniston-Film zu zeigen, bedeutet gleichermaßen, seine Existenz zu leugnen. Einen Afroamerikaner als Kriminellen zu porträtieren, anstatt ihn als seriösen Anwalt im Chefsessel vorzustellen, bedeutet, gesellschaftliche Stigmata zu bekräftigen. Woher soll ein vietnamesisches Mädchen wissen, dass sie eine Superheldin sein kann, wenn kein Held so aussieht wie sie? Woher soll ein weißes Kind wissen, dass Qualitäten wie Mut, Intelligenz und Humor keine Hautfarbe haben, wenn es sie nur mit seiner eigenen assoziieren kann?
„Was ich einfach nicht verstehe, ist, weshalb es nicht zwei Inder in der Show geben kann“, sagt Dev in der Serie „Masters of None“ zu seinem Filmproduzenten Jerry. „In jeder Serie gibt es zwei Weiße und keiner beschwert sich darüber.“ „Wir sind noch nicht an diesem Punkt angekommen“, gibt dieser schließlich zurück. Und gerade diese Floskel versetzt mich in traurige Aufruhr: Wenn das Ändern des Geschlechts einer Hauptfigur noch zu generellem Aufschrei führt, wenn die Wichtigkeit von Vielfalt noch nicht mal im eigenen Wohnzimmer akzeptiert wird, wenn Identifikation immer noch mit der Hautfarbe zusammenhängt – mein lieber Jerry, wie weit sind wir dann eigentlich gekommen?
[box type=“shadow“ ]Der Bechdel-Test
Diskriminierung in Hollywood gilt nicht nur für die Hautfarbe: Auch Schauspielerinnen werden häufig in die Nebenrolle der unterstützenden Ehefrau gezwängt, um Platz für die männliche Hauptrolle zu schaffen. Der 1985 verfasste „Bechdel-Test“ der amerikanischen Zeichnerin Alison Bechdel fordert dazu auf, jedem Film drei einfache Fragen zu stellen: 1. Gibt es mindestens zwei benannte Frauenrollen? 2. Sprechen sie miteinander? Und noch viel wichtiger: 3. Unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann? Star Wars fällt durch: Außer Prinzessin Leia bleiben weiblichen Charakteren bei einer 386-minütigen Gesamtlaufzeit der Originaltrilogie stolze 63 Sekunden Präsenzzeit. [/box]
Von Sonali Beher