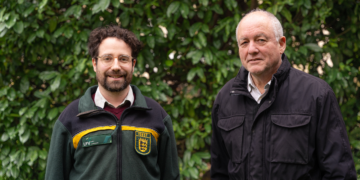Ein Gespräch mit Jonas Lüscher über „Kraft“, das Schreiben und den digitalen Fortschritt
Wir trafen Jonas Lüscher zum Gespräch über „Kraft“ – Lüschers ersten Roman, der einen Aufenthalt des Rhetorikprofessors Richard Kraft im Silicon Valley zum Gegenstand hat. Dieser will dort einen achtzehnminütigen Vortrag erstellen und halten, der die Frage in Anlehnung an Leibniz‘ Theodizee-Frage beantworten soll: „Warum alles, was ist, gut ist und wir es dennoch verbessern können?“ Ausgelobt ist ein Preisgeld in Höhe von einer Million US-Dollar, das Kraft meint zu benötigen, um sich aus seiner Ehe „freikaufen“ zu können. Das Schreiben des Vortrags will nicht recht gelingen, der Leser lernt Kraft, dessen Leben und Gedanken kennen. Im Grunde geht es in „Kraft“ um das Aufeinanderprallen des „alteuropäischen“ Gedankenguts mit der fortschrittsoptimistischen Ideenwelt des Silicon Valley.
Jonas Lüscher, geboren 1976 in der Schweiz, lebt – nach Entscheidung gegen eine Karriere in der Wissenschaft – als freischaffender Autor in München. Seine erste Novelle, „Frühling der Barbaren“, war für den Deutschen und Schweizer Buchpreis nominiert, wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und für das Theater adaptiert.
Die ersten Skizzen für „Kraft“ sind während eines Forschungsaufenthaltes an der Stanford University entstanden. Worüber haben Sie dort geforscht und wie sah der Schreibprozess aus?
Jonas Lüscher: Ich habe dort an meiner Dissertation gearbeitet – die ich mittlerweile an den Nagel gehängt habe –, es ging um die narrative Beschreibung sozialer, komplexer Probleme, eine Art Plädoyer für eine „narrative Gesellschaft“, für eine Abwendung vom quantitativen, mathematischen Denken. Es ging darum, zu zeigen, aus welchen erkenntnistheoretischen Gründen wir davon ausgehen können, dass Literatur autoritatives Wissen trägt. Und ich habe viel zu Richard Rorty gearbeitet, der einen Lehrstuhl für Komparatistik in Stanford hatte. Das war einer der Gründe, warum ich dorthin wollte. Am Ende meiner Zeit dort habe ich wieder angefangen, literarisch zu schreiben, ich wollte ein Buch schreiben über die Diskrepanz zwischen dem Technik- und Fortschritts-Optimismus des Silicon Valley und dem, was Donald Rumsfeld eben „old Europe“ geschimpft hat. Dieser Roman „Kraft“ begann als Erzählung; ich dachte, es würde eine kurze Erzählung von 30–50 Seiten. In Stanford habe ich nur zwei Drittel des ersten Kapitels geschrieben, dann kam „Frühling der Barbaren“ heraus und ich war so mit Lesereisen etc. okkupiert, dass ich erst danach weiterschreiben konnte.
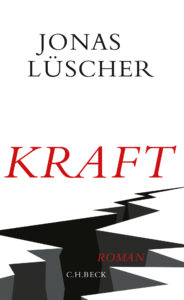
Weshalb haben Sie Ihre Dissertation aufgegeben?
Lüscher: Es gibt einen simplen, pragmatischen Grund: „Frühling der Barbaren“ war so erfolgreich, dass ich wahnsinnig viele Lesungen hatte, ich wurde auch oft in’s Ausland eingeladen zu Lesungen – das hat viel Zeit geschluckt. Ich hatte zwar eine schön dotierte Doktorandenstelle, aber ich war kaum mehr dort und das ging auch den Kollegen gegenüber nicht mehr. Und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt noch ein neues Buch schreiben will, passt das nicht mehr zusammen. Zum anderen habe ich ja diese These, dass wir uns in Richtung einer literarischen Gesellschaft bewegen sollten und als ich als literarischer Schriftsteller reüssiert hatte, musste ich mir schon die Frage stellen, warum überhaupt einen weiteren „theoretischen“ Text schreiben, statt eines Romans, wenn ich meine eigene These ernst nehme. Auch wurde mir das akademische Philosophieren zur Last, das sprachliche Korsett und vor allem die Suche nach Präzision hat mich mehr und mehr frustriert. Es schien mir, je präziser ich werde, desto glitschiger wird der Fisch und der Gedanke entgleitet mir. Die Forderung nach Präzision hat gar nicht mehr meinem Denken entsprochen, sie hat mich nicht mehr interessiert, sondern gerade das Vage, Vielfältige, Zerrissene – eine Figur wie dieser Kraft, der immer zerrissen ist, der hin und her überlegt und dessen Gedanken oszillieren – das hat mich plötzlich interessiert. Die Suche nach Präzision hat mich unglücklich gemacht. Es war ein Befreiungsschlag.
Wie schreiben Sie? Auf Papier, mit Textverarbeitungsprogrammen oder ganz anders?
Lüscher: Auf dem Laptop, aber ich habe ein spezielles Textverarbeitungsprogramm namens „iA Writer“, es wurde, glaube ich, an der ETH Zürich entwickelt. Es ermöglicht ein ganz fokussiertes Schreiben, mit einer Schrifttype, einer Schriftgröße, man kann weder fett noch kursiv setzen und kann den Satz, an dem man arbeitet, hervorheben, während der Rest im grauen Hintergrund verschwimmt. Wenn ich mit „Word“ oder „Open Office“ schreibe finde ich es ästhetisch unerträglich, wenn so viele Menü-Optionen herumschwirren. Für mich ist beim Schreiben der einzelne Satz die Größe, über die ich nachdenke; und dann finde ich es schön, wenn dieser Satz so herausgehoben ist. Wobei meine Sätze manchmal so lang sind, dass sie dann doch die ganze Seite füllen…
Schreiben Sie flott und feilen dann lange am Text? Hier ein Wörtchen anders, dort ein Semikolon statt eines Kommas?
Lüscher: Nein, es ist gerade umgekehrt. Ich schreibe wahnsinnig langsam und denke viel nach am Schreibtisch. Ich sitze dort beinah regungslos, ohne zu schreiben, nachdenkend. Und erst wenn ich weiß, was in einen Satz soll und wie ich es gestalten will, schreibe ich diesen Satz. Daran wird dann nicht mehr viel geändert. Viele Autoren sagen: „Zwanzig Prozent Schreiben, achtzig Prozent Überarbeiten“ – bei mir ist das umgekehrt. Das skizzenhafte Schreiben frustriert mich, was auf’s Papier beziehungsweise auf den Bildschirm kommt, muss schon Hand und Fuß haben.
„Kraft“ und „Frühling der Barbaren“ zeichnen sich durch ihre Sprache und Formulierungen aus, nicht zuletzt durch Sprachwitz. Wie entsteht dieser? Fällt er Ihnen zu oder müssen Sie ihn konstruieren?
Lüscher: Er fällt mir zu im Schreibprozess. Ich muss manchmal gegen den ironischen Ton ankämpfen, er fällt mir sehr leicht, aber ich muss aufpassen, dass er nicht zu einer Masche wird. Für mich ist die Recherche unheimlich wichtig, ich recherchiere immer und sie treibt die Erzählung voran. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass ich diesen „Bonner Kanzlersturz“ so ausführlich beschreiben werde. Ich kannte die Geschichte nur in Grundzügen und schaute mir dann die Bundestagsdebatte auf „YouTube“ an – und hier muss ich eine Lanze brechen für die neuen Medien als Recherchemedium, fantastisch! Ich weiß gar nicht, wie man das früher hätte machen sollen, wahrscheinlich hätte man sich für viel Geld eine DVD vom ZDF schicken lassen müssen, oder noch schlimmer: eine Videokassette. Und diese Menge an Recherchematerial treibt mich voran und bringt mich auf Ideen. Ich gucke dann zwei-, dreimal diese Debatte und entdecke ein Detail, etwa die Gesichter der Familie Kohl, während jener zum Kanzler gewählt wird und daraus kann ich dann etwas machen. Von einem Lehrer im Lehrerseminar in der Schweiz habe ich gelernt, für alle Quellen offen zu sein. Er konnte die Dinge wunderbar miteinander verknüpfen. Er hatte mehrere Zeitungen abonniert, selbstverständlich Die Zeit, die NZZ, aber auch den Playboy und den Kicker. Das hat mich sehr beeinflusst.
Wieviel Kraft steckt in Lüscher?
Lüscher: Ich hoffe, nicht allzu viel! Aber ich würde sagen, dieses Ringen mit der Lebensform des Fuchses und die Sehnsucht nach der Sicherheit einer Igel-Existenz ist mir gar nicht fremd.
Wie stehen Sie denn persönlich zum digitalen Fortschritt? Sind Sie so ambivalent, wie Kraft es ist?
Lüscher: Ja, ich denke schon. Aber ich glaube, dass es fast die einzige Möglichkeit ist, damit umzugehen. Natürlich profitiere ich unheimlich davon, ich wüsste zum Beispiel gar nicht, wie ich eine Lesereise organisieren sollte ohne Smartphone. Das alles ist natürlich hilfreich. Ich bin auch ein fanatischer, ja fast süchtiger Zeitungsleser und lese gern internationale Zeitungen online. Es ist aber sehr ambivalent: Einerseits ist es ganz toll, andererseits ist es schon fast eine Sucht und ich denke: Bringt es das überhaupt oder ist es nicht unendliche Zeitverschwendung? Und ich glaube schon, dass man etwas die Konzentration verliert, wenn man sich zu viel mit diesen Medien beschäftigt. Ich habe manchmal den Eindruck, es gibt immer mehr Leute, die kaum die Geduld aufbringen für Bücher oder lange Reportagen. Dieses Fragmentierte der Wahrnehmung scheint mir schon seine Ursache in diesen Medien zu haben. Und sie haben ein hohes Suchtpotential, das spüre ich selbst. Ich habe ein Programm, das heißt „SelfControl“, und da kann man selbst angeben, wie lange man kein Internet- oder E-Mail-Zugang haben will und dann wird er gesperrt, selbst bei einem Neustart des Systems bleibt er gesperrt. Es gibt Phasen in meinem Schreiben, in denen ich dieses Programm leider brauche. Und das ist bizarr, dass wir uns mit seltsamen Programmen wiederum vor Programmen schützen müssen.
Können Sie Ihr Verhältnis zur Lektüre im 21. Jahrhundert darlegen? Lesen Sie „analog“ oder digital?
Lüscher: Ich habe das digitale Lesen eine Weile versucht. Als ich in Amerika war, habe ich mir einen E-reader besorgt und es war schon praktisch, weil ich mir dort deutsche Bücher herunterladen konnte und Zugriff auf die ganzen Klassiker hatte. Aber ich habe den Reader sehr bald weiterverschenkt, weil es mir tatsächlich nicht so recht Spaß macht mit dem Ding zu lesen. Ich finde, es ist ein Problem, sich im Buch zurecht zu finden. Das visuelle Gedächtnis – „auf der linken Seite im oberen Drittel“ – geht komplett verloren. Für mich ist es auch ein wichtiger Moment, irgendwann mein Manuskript auszudrucken und es auf Papier zu lesen, denn das ist ein ganz anderes Leseerlebnis, als wenn ich meine Sachen auf dem Rechner lese: Ich bin konzentrierter, ich bin fokussierter, aber letzten Endes bin ich mir nicht sicher, ob das eine Frage der Generation ist oder ob nicht dereinst eine Generation heranwachsen wird, die das überhaupt nicht mehr so erlebt und mit diesem Digitalen problemlos umgehen kann. Ich finde es auch einen zweifelhaften kulturkritischen Impetus, wenn man sich dann über das digitale Lesen irgendwie mokiert – das würde ich nicht –, aber ich lebe schon gern mit gedruckten Büchern, ich finde es schön, die Bücher, die ich gelesen habe, die einen wesentlichen Teil meines Lebens ausmachen, um mich zu haben in meiner Wohnung. Ohne sie würde für mich persönlich etwas verloren gehen.
Sind Sie und der Verlag zufrieden mit dem Verkauf Ihres Buches? Und wie ist die Resonanz der Leserinnen und Interessierten bei Veranstaltungen bislang?
Lüscher: Der Verlag ist sehr zufrieden, für mich ist es auch schön. Die Kritik in allen wichtigen Zeitungen kam sehr geballt, das ist immer erfreulich für den Verlag, aber auch für mich, denn das ist eine anstrengende Zeit, wenn die Kritiken kommen und es ist schön, wenn das alles vorüber ist. Die Reaktionen der Leser sind unterschiedlich: Man muss das schon mögen, was ich da mache. Man muss sich einlassen auf geistesgeschichtliche Ideen, auf gewisse philosophische Ideen – wenn einem ein Wort wie „Theodizee“ erst einmal Angst macht und man gar nicht lernen will, was das bedeutet, dann ist es nicht das richtige Buch. Bei einer Lesung stand ein Herr auf und meinte, das ginge ja gar nicht mit diesen langen Sätzen, es sei furchtbar. Ich vermute, er war Deutschlehrer und hatte seinen Schülern vierzig Jahre beigebracht, man müsse viele Punkte machen. Mich hat das als Schüler schon geärgert, denn das Problem ist nicht der lange Satz an sich, das Problem ist der lange schlechte Satz. Die meisten Schüler schreiben Bandwurmsätze, die sie mit „und, und, und“ konstruieren – das ist schrecklich, ja. Aber ansonsten ist der Punkt etwas überschätzt.
Was steht nach der Vermarktung von „Kraft“ auf Ihrer Agenda? Schreiben Sie bereits wieder?
Lüscher: Ich kriege jetzt wieder richtig Lust zu schreiben. Als im letzten Herbst der Text abgegeben war und das Buch in Druck ging, war es für mich sehr schwierig, etwas Neues anzufangen, weil ich nervös war. Der eigene Qualitätswahn hat mich beim Schreiben so beschäftigt, dass ich gar nicht den Druck von außen gespürt habe. Aber als das Buch fertig war und die Leseexemplare massenhaft hinausgingen, dachte ich plötzlich: Was habe ich da gemacht, hätte ich dies oder jenes nicht anders schreiben müssen? Aber jetzt kommt die Lust wieder. Ich habe ein Stückvertrag mit einem Theater, das ist mein nächstes Projekt.
Woran denken Sie zuerst, wenn Sie „Heidelberg“ hören? Denken Sie an das Schloss, an die Universität oder die UNESCO City of Literature?
Lüscher: In erster Linie ist Heidelberg für mich eine Universitätsstadt. Ich kenne Heidelberg nicht besonders gut, aber ich begegne Heidelberg immer im universitären Kontext. Es ist die klassische, deutsche Universitätsstadt.
Das Gespräch führte Florian Schmidgall
Merken
Merken
Merken