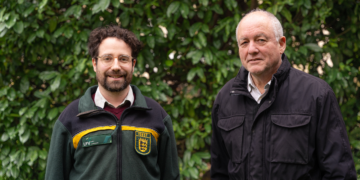Warum „jung und schön“ für Ronja von Rönne alles andere ist als ein Kompliment und wie die Autorin zu Öffentlichkeit und Journalismus, ihren Protagonisten und Donald Trumps Pressesprecher steht, verrät sie im Interview.
Jung, fetzig, flippig, dynamisch. Das Image der gefeierten Jungautorin Ronja von Rönne (25) gleicht den Attributen der Generation Y. Das mag unter anderem an ihrer ungewöhnlichen Karriere liegen: In Berlin geboren und in einem Dorf in Bayern aufgewachsen, flieht sie zum Studieren in die Großstadt. Sie betreibt den Blog „Sudelheft“, den, wie sie sagt, „außer meiner Großmutter niemand gelesen hat“. Inzwischen ist Rönne auf Lesungen in der ganzen Republik anzutreffen. Im Juli war sie zu Gast im Heidelberger Karlstorbahnhof, las bei einer von der studentischen Initiative Querfeldein organisierten Veranstaltung aus ihrem Buch „Heute ist leider schlecht. Beschwerden ans Leben“, das im März dieses Jahres im Aufbau-Verlag erschienen ist. Die Möglichkeit, Ronja von Rönne näher kennen zu lernen.
Du hast in München, Wien und Hildesheim studiert. Auch Heidelberg ist eine Studentenstadt. Was ist für dich das Beste am Studentenleben?
Vor allem, dass es irgendwann vorbei ist und man dann darauf zurückblicken kann. Man darf nicht in großen Städten studieren, nur in kleinen, da ist alles so wie es sein sollte. Man verliert sich nicht, kann Sachen organisieren, die groß werden und sich mehr leisten als beispielsweise in München. Und ich habe gehört, man lernt auch was.
Du bist über Deinen Blog „Sudelheft“ zum klassischen Journalismus gekommen. Was macht Dir an dieser Arbeit am meisten Spaß?
Die Nebeneffekte, wie gelesen oder gelobt zu werden. Die Kehrseite ist eher unangenehm. Außerdem kann man Einfluss nehmen, den Leuten neue Denkanstöße geben und einen Effekt haben, fast egal welchen, sodass man sich daran erfreut oder daran reibt. Man bekommt ein Gefühl von Dasein durch die Veröffentlichungen, was sich verliert, wenn man den ganzen Tag Netflix schaut, wie ich es sonst mache.
Zwischen Shitstorm und Preisangeboten hast Du einige ambivalente Erfahrungen im Journalismus gesammelt. Warum sollte man heute Journalist werden und was muss man beachten?
Man sollte sich an Jan Böhmermann halten, der Journalisten dazu auffordert, den Blick über den Tellerrand der klassischen Zeitung zu heben und zum Fernsehen zu kommen. Unser Fernsehen ist nach wie vor – gerade die öffentlich-rechtlichen Sender – miserabel und da kann man gute, schlaue Köpfe gebrauchen. Ich würde mich freuen, wenn sich all diese Journalisten dahin kehren und sich abwenden von dem reinen „Ich möchte mal zu Spiegel Online“. Das ist auch ganz schön, aber da gibt es schon gute Leute.
Siehst Du überhaupt eine Zukunft für das traditionelle Printmedium?
Ja, aber eher eine magazinige Zukunft. Tageszeitungen sind outdated, da man Informationen auch einfacher erhalten kann. Dafür ist es angenehmer, Essays in Ruhe in Papierform zu lesen anstatt mit nicht funktionierendem WLAN in der Bahn.
Wie auch andere aktuelle Autoren verfügst Du über eine starke mediale Präsenz. Was reizt Dich am meisten an der Öffentlichkeit?
Öffentlichkeit ist nicht nur schön: Auf der Bühne ist die Bekanntheit toll, aber nicht in der Kneipe, wenn andere Leute einen anquatschen, ob ich nicht Ronja sei. Bekannt sein ist kein Lebensziel an sich. Es rechtfertigt vielleicht, dass man gute Buchverträge bekommt und vom Schreiben leben kann. Für diesen Luxus muss man dankbar sein. Bei der medialen Präsenz muss man aufpassen, was man in den sozialen Netzwerken tut. Ich glaube, dass ich das ganz okay mache, weil ich es persönlich gestalte, aber eigentlich nie viel verrate, sondern immer nur drum herumrede. Das machen viele ernsthafte Kollegen anders, die ihr mediales Auftreten mit der eigenen Person verknüpfen, indem sie nicht nur politische Analysen schreiben, sondern eigene Blickpunkte anbieten. Als Identifikationsfigur ist das wichtig, so erreicht man vielleicht auch ein jüngeres Publikum. Häufig werden die Leute aber auch für mehr Klicks durch eine nicht zum Artikel passende Überschrift irgendwo hingelenkt, wo sie gar nicht hinwollten. Das finde ich echt unschön.
Vor zwei Jahren hast Du geschrieben, dass der Feminismus Dich „anekelt“. Du hast Dich gegen den Netzfeminismus gestellt – daraufhin gab es einen großen Shitstorm. Nun wirst Du teilweise auf den Feminismus-Artikel reduziert, andererseits aber auch auf Dein Aussehen. Wie stehst Du dazu?
Ich glaube, die Bezeichnung als „jung und schön“ erledigt sich von selbst. Mit dem Label muss man sich nicht ewig herumschlagen. Es ist schwierig, das nicht als Kompliment zu sehen – denn das ist es überhaupt nicht. Das wäre es vielleicht, wenn deine Oma sagt „Du siehst ja süß aus!“, aber wenn das Fremde sagen, dann ist es eher ein Kleinmachen. Dagegen muss man sich wehren. Ich sehe aber nicht ein, dass ich mich deswegen nicht mehr schön anziehen darf. Ich mag schön sein, ich finde viele andere aber auch schön. Dass man häufig danach gefragt wird, ist wahrscheinlich eher ein Frauending.
In Deinem Buch „Heute ist leider schlecht. Beschwerden ans Leben“ ist die Ich-Erzählerin oft eine weibliche, junge Journalistin mit Panikattacken. Inwiefern identifizierst Du Dich mit ihr?
Ich habe Mitleid mit all meinen Figuren, weil sie tun müssen, was ich ihnen sage. Ich selbst bin das überhaupt nicht. Ich habe in diesem Buch eine sehr passive Erzählerin gewählt, damit die anderen Figuren mehr leuchten können. Aber ich hoffe, dass ich nicht ganz so neurotisch bin. Das sind wahrscheinlich meine schlechtesten Eigenschaften und Gedanken, die ich am liebsten nicht hätte.
Welche Unterschiede gibt es zwischen Rolle und Realität?
Die Unterschiede zwischen ihnen verschwimmen. Ich würde nichts von mir geben, hinter dem ich nicht stehen kann. Die Art und Weise allerdings, wie ich es von mir gebe, die Härte, der Witz, ist literarisiert. Dieses Bild ist etwas Anderes, als das, was ich wirklich bin. Ich glaube, man muss einen Teil von sich vor all dem schützen, was da draußen ist, da sonst jedes „Ich hasse dich, du Schlampe“ nicht nur auf deine Literatur, sondern auch auf dich selbst bezogen ist. Das will ich tunlichst vermeiden.
Du schreibst über IKEA, aber auch über aktuelle Diskurse, wie die Homo-Ehe oder die AfD. Was sagst Du zum Rücktritt von Trumps Pressesprecher Sean Spicer?
Das ist alles so weird. Es ist schwierig, diese Nachrichten so zu konsumieren, dass es wirklich passiert und keine Folge von House of Cards ist. Vieles ist so absurd und liest sich wie ein Krimi. Man staunt, dass ein Mensch wie Donald Trump tatsächlich Präsident geworden ist. Ich kann mir sogar vorstellen, warum man ihn wählt: damit einfach mal etwas passiert. Das ist, wie wenn man zündelt, um zu schauen, was passiert – das ist natürlich auch falsch. Ich verfolge die aktuellen Diskurse zwar, allerdings unterscheide ich mich in meinem Urteil nicht von den meisten Leuten, die das genauso wie ich mitbekommen.
Du schreibst über Politik, indem du dich auf solche aktuellen Themen beziehst. Wie politisch kann Kunst sein?
Sie kann politisch sein, muss es aber nicht. Ich finde es immer anstrengend, wenn der Kunst vorgeworfen wird, sie sei unpolitisch, nur weil sie sich nicht direkt mit Menschen auseinandersetzt. Deswegen muss sie nicht gleich begeistern. Natürlich stimmt der alte Spruch, dass das Politische im Privaten ist. Wie ich mich verhalte, wie ich spreche, ob ich in meinen Texten Frauen unterbringe, ist politisch. Mit jeder Kaufentscheidung bei Lidl hat man eine größere politische Meinung abgegeben, als bei der Abgabe einer Stimme bei der Wahl. Kaufentscheidungen sind daher auch politisch, weshalb man sich gar nicht unpolitisch verhalten kann. Ich glaube nicht an unpolitische Menschen. Wenn man bei Lidl oder dem Bioladen einkauft oder sich engagiert, wenn man sich die Kindererziehung mit der Freundin teilt, dann ist das extrem politisch – selbst wenn man das nicht bewusst wahrnimmt. Es macht keinen großen politischen Unterschied, ob ich direkt über die AfD oder über Ängste schreibe und warum Leute aus Ängsten heraus wählen.
Rezensenten nennen deine Bücher oft sprachlich interessant und witzig geschrieben, aber inhaltsleer. Wie würdest Du selbst Deinen Stil beschreiben?
Ich habe damals beim Schreiben „Rheinsberg“ von Tucholsky gelesen. In diesem Buch passiert nichts. Ein verliebtes Paar fährt in die Ferien nach Rheinsberg und kommt glücklich wieder zurück. Das wars. Zwischendurch machen sie ein bisschen Quatsch mit der Kamera, die sie dabeihaben. Das war für mich ein totaler Trost. Man braucht nicht viel Plot, um interessant zu schreiben. Ich wollte ein Streufeuerwerk der Literatur schaffen, das in Nebensätzen bezaubernd ist oder zum Lächeln bringt. Wer einen krassen Plot will, sollte sowieso keine klassische Literatur lesen, sondern einen tollen Thriller. Ich finde es komisch, dass Anforderungen an Literatur immer mit einer Handlung verbunden werden. Auch bei „Faserland“ von Christian Kracht passiert nichts, der Protagonist fährt nur einmal durch Deutschland und es hat trotzdem Spaß gemacht. Ein Buch muss nur irgendwie unterhalten: Wenn es durch Plot unterhält, ist es toll. Wenn es durch Sprache unterhält, ist es toll. Und wenn man sich total langweilt, sollte man es wegschmeißen.
Der dritte Teil Deines neuen Buches lautet „Was gegen das Schlimme hilft“ und beschreibt damit eine Steigerung zum Positiven und zur Harmonisierung. Was möchtest Du mit Deiner Literatur bewirken?
Ich wünsche immer, dass Hoffnung durchschimmert. Aber für mich kann Hoffnung immer nur dann durchschimmern, wenn man einräumt, dass es davor schlimm war. Man hat einen Hang zum Leiden und Einreden, dass etwas nicht gut genug ist, aber erst zu sagen: „Wir sind alle so“ und dann: „Es kann etwas helfen und wir sind dem nicht alle total ausgesetzt“ funktioniert nicht. Es ist wie in einem gemeinen Hollywoodfilm: Erst einmal muss alles schlecht sein, damit man dann das Happy End genießt. Denn einen Film, der schön ist und bei dem alle happy sind, den sieht niemand an.
Du hast bereits im Journalismus gearbeitet und zwei Bücher herausgebracht, was kommt als nächstes?
Ich mache jetzt eine kleine arte-Sendung. Sie läuft ab Oktober und heißt „Street Philosophy“. Die Protagonisten sind toll, ob ich so toll bin, weiß ich nicht. Es wird immer um ein philosophisches Thema gehen, zum Beispiel die Natur. Man trifft verschiedene Leute, die damit unterschiedlich umgehen. Ich habe einen Jäger getroffen, einen Berliner Naturschamanen, der mit Bäumen redet. Und einen Dandy, der die Natur hasst und die Vorstellung, in den See zu springen, widerlich findet. Es ist ein sehr ruhiges Format und macht mir viel Spaß. Irgendwann schreibe ich hoffentlich wieder ein Buch. Ich habe schon Lust, dass es gut wird, aber die Arbeit an sich … Ich arbeite einfach extrem ungern, immer.
Das Interview führte Livia von Oldershausen.