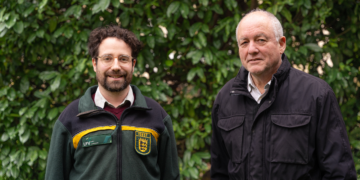Es raschelt leise in der Jesuitenkirche. Die letzten Zuschauer rücken noch ihre Krägen zurecht, ziehen den Mantel noch ein bisschen enger um den Körper. Da kommt ein Ton. Scharf, knallig ja fast perkussiv streut die Oud, die orientalische Laute von Moneim Adwan, erst einzelne Töne, Tonblöcke, schließlich Melodien in den weiten Raum der Kirche. Sphärisch ist das – und dann fängt Adwan mit seinem warmen Tenor an zu singen. Er zitiert das berühmte „Flow my tears“ des englischen Renaissancekomponisten John Dowland, entwickelt aus wenigen Tönen eine ganze Linie arabischer Melodik. Sein Gesang steigert sich immer mehr, endet schließlich auf einen schmerzlichen Schrei. Kaum ist sein Ton verklungen, erhebt sich eine andere Stimme hinter den Zuschauern. Olga Pasichnyks reifer, volltönender Sopranklang flutet die Kirche, nimmt die Ohren ein mit zwingender Präsenz. Begleitet von Bernard Foccroulle an der Orgel besingt sie nun Dowlands gebrochenes Herz in ganz klassisch europäischer Musiktradition. Nur wenig später steigt auch Adwan wieder ein, bereichert den Ton mit seiner Oud. Das klingt ganz anders – und passt doch wunderbar.
Es sind besonders die beiden Stücke „Dialogue about ‚Flow my tears‘“ und „Lamma Bada Yatathanna“, an denen „The hundred colours of exile and love“ seine ganz eigene Magie entwickelt. Die drei Musiker kreuzen klassisch arabische Melodik mit der europäischen Musik aus Barock und Renaissance, Oud mit Orgel, Pasichnyks vollen, dramatischen Sopran mit dem leiseren, zurückhaltend und doch nicht weniger intensiven Tenor Adwans. Was bei weniger talentierten Künstlern furchtbar schief gehen kann, wird an diesem Abend zur ganz hohen Kunst.
Während die Künstler Anfang und Ende des Konzerts zu dritt gestalten, musizieren sie im Folgenden meist zu zweit oder sogar solistisch. Das Programm ist eine bunte Zusammenstellung aus zeitgenössischer arabischer Musik, davon vier Kompositionen Adwans, und der alten Meister rund um Bach, Purcell und Buxtehude. Exil, Exil in der Liebe, Liebe als Rettung aus dem Exil – diese Linien bestimmen den Abend, verbinden ganz unterschiedliche Ansätze zu einem großen Panorama von Freude und Trauer, Hoffnung und Verzagen, Einsamkeit und Melancholie. Das ist schön, manchmal mitreißend. Die Akustik ist dabei leider nicht immer ein Segen. Während Foccroulle auf der kleinen Seitenorgel Bachs „O Mensch bewein dein Sünde gross“ mit intimer, feiner Präzision entrollt, gehen die fein ziselierten Linien des „Tiento de tiple de segundo tono“ von Francisco Correa de Arauxos auf der Hauptorgel im Hall der Jesuitenkirche unter. Und bei Strozzis „Che si può fare“ hat selbst Pasichnyk Probleme, gegen ihr eigenes Echo anzusingen.
Dass die teils ungünstige Akustik ein Schönheitsfehler bleibt, liegt ganz an den Künstlern. Das sieht das Publikum offenbar auch so. Und lässt die Musiker erst nach drei Aufgängen gehen.
Von Jakob Bauer