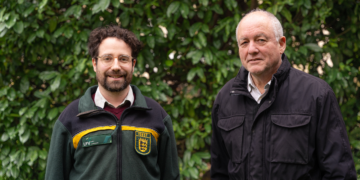Studentisches Leben im Heidelberg der Sechziger – der Aktivist Burkhart von Braunbehrens hält 50 Jahre nach Flower-Power und freier Liebe Rückschau
Die 68er protestierten in Westdeutschland gegen den Autoritarismus ihrer Elterngeneration und kämpften für Freiheit und Emanzipation. Auch in Heidelberg tobten zwischenzeitlich fast wöchentlich Proteste. Burkhart von Braunbehrens war laut taz „Kopf der Studentenbewegung“ und blickt im Gespräch mit dem ruprecht zurück.
Wie sind Sie ein „68er“ geworden?
So 1964 brachte der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) in Heidelberg ein Flugblatt zum Vietnamkrieg heraus. Das hat mich tatsächlich aufgerüttelt. Denn da wurde das erste Mal berichtet, was die USA dort taten. Deshalb bin ich zum SDS gegangen. Damals war dieser noch ein kleiner Studierzirkel, der sich meist in einer Kneipe traf. Rudi Dutschke hat in dieser Zeit für uns eine große Rolle gespielt, weil er von uns linken Studierenden forderte, die ganze kommunistische Literatur als Quelle zu nutzen, nicht nur Marx und Engels. Die Fähigkeit, sich nach außen zu vermitteln, hat den damaligen Leuten völlig gefehlt, weil sie so Studienköpfe waren. Mein erstes Gefühl war deshalb: Das müssen wir erstmal umkrempeln. Wir haben dann im Studentenparlament mitgewirkt – erst noch als kleine Minderheit.
Welche Proteste der folgenden Jahre sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
Im „Kakaobunker“, einer Cafeteria im Keller der Neuen Uni, wurde viel diskutiert. Wir haben in der Universitätsgeschichte herumgegraben und viele Professoren waren vorbelastet. Deshalb haben wir „Go-Ins“ gemacht. Du gehst in eine Vorlesung rein, störst und stellst kritische Fragen. Auf unsere Konfrontationen reagierten die Professoren oft heftig. Eine meiner ersten Heldentaten war, eine Demonstration gegen Fahrpreiserhöhungen zu organisieren. Über 1000 Leute folgten unserem Flugblatt auf den Uniplatz. Es lag in der Luft, dass man was unternehmen musste. Einmal haben wir am helllichten Tag Plakate der NPD am Bismarckplatz abgerissen. Dadurch wurden wir natürlich notiert. Ein anderes Mal wurde das Amerikahaus aus Protest komplett eingewickelt. Ich hatte damals, glaube ich, über 30 Verfahren. Zu der Zeit gab es fast wöchentlich Demonstrationen in Heidelberg. 1972 habe ich dann mit 15 anderen linken Organisationen eine Vietnam-Demonstration in Bonn organisiert – mit fast 100 000 Teilnehmenden.
Hatten Sie wirklich das Gefühl das System verändern zu können?
Ja. Wir hatten die Illusion, dass wir den ursprünglichen kommunistischen Gedanken wieder zu neuer Reinheit bringen könnten. Das hing auch mit der Dritte-Welt-Bewegung zusammen. Wir dachten, dass die Kulturrevolution in China die reine Linie des Kommunismus verkörpern würde. Man hatte das Gefühl: Das ist das, was an Gutem gerade auf der Welt passiert – eine weltweite, starke Bewegung.
Hat das Studium unter dem Engagement gelitten?
Ein reglementiertes Studium gab es in den ganzen Geisteswissenschaften recht wenig, ich habe insgesamt zehn Jahre an der Uni verbracht und alles Mögliche studiert. Mir hat das selbstständige Studieren im SDS viel gebracht, auch um Texte schneller zu verstehen und einzuordnen.
Wann kam dann die Ernüchterung ?
Die Unterstützung des antikolonialen Kampfes – Vietnam natürlich an erster Stelle – das war eine wichtige Säule im Kampf der Studentenbewegung. Der Zusammenbruch aber, dass diese ganzen Regierungen, die wir unterstützt hatten, sei es Kambodscha oder Simbabwe, alle korrupt bis verbrecherisch geworden waren, das war ein Schock. Mir war klar, ich kann mich jetzt in kein neues politisches Projekt stürzen. Ich fühlte mich schon beschädigt. Ich war immerhin bis 1975 in relativ hoher Verantwortung im „Kommunistischen Bund Westdeutschland“ und hatte den mitgegründet. Was war richtig? Was war falsch? Man musste das völlig neu überarbeiten – das ist ein Prozess, der nicht abgeschlossen ist.
Welche Gewinne hat die Studentenbewegung gebracht?
Wir haben uns zum Beispiel als Studenten damals nicht geduzt, das haben wir durchgesetzt. Wir waren auch mit in den Kommissionen, als neue Hochschulgesetze diskutiert wurden, und haben die Drittelparität gefordert. Ein weiterer Gewinn ist, glaube ich, dass heutige Bewegungen weniger Tendenz haben, sektiererisch zu werden als wir, sie sind offener und demokratischer. Das Ende der 70er war eine herbe Enttäuschung. Ohne die Gründung der Grünen, wäre das völlig verloren gegangen.
Wie konnten Sie Ihre 68er-Ideale mit Ihrer Aktivität im Aufsichtsrat des Rüstungskonzerns Krauss-Maffei Wegmann durch Ihre geerbten Firmenanteile vereinen?
Wir haben damals eigentlich immer eine ziemlich klare Vorstellung gehabt, dass Pazifismus nicht funktioniert. Ich persönlich würde es begrüßen, wenn mehr Linke sich um Militärfragen kümmern und da mitmischen würden, weil dieses reflexartige Dagegensein nur dazu führt, dass der Bereich vollkommen von Konservativen dominiert wird. Man darf von den Rüstungskonzernen kein moralisches Handeln verlangen. Die Politik muss da das Zepter in die Hand nehmen.
Denken Sie, dass im heutigen System noch einmal ein ähnlich bedingungsloser Protest wie damals entstehen könnte?
Wir leben wirklich in einer schwierigen Situation. Es wäre wichtig, dass eine neue Studentenbewegung entstehen würde, egal, an was sie sich entzündet. Wo die Studenten dagegen kämpfen, eingeengt im Fachstudium zu sein, um Luft für andere Dinge zu gewinnen. Es ist schwer, gegen das aktuelle System zu kämpfen, weil in der Politik fest verankert ist, dass der Neoliberalismus gut ist – obwohl er so viel Unheil angerichtet hat. Die völlige Überzeugung wie bei uns damals gibt es heute vielleicht noch in der feministischen Bewegung. Da gibt es tatsächlich noch Leute, die bei jedem Gedanken, der ihnen kommt, nach dem Raster untersuchen: Ist da etwas Machomäßiges dabei? Kann man das als Feministin noch vertreten?
Das Gespräch führten Alexandra Koball und Céline Jacamon.