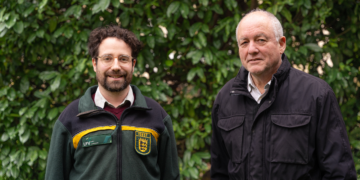Marcel Wälde hat sich in einer Hausarbeit mit aufblasbarer Architektur beschäftigt – ein untypisches Thema in der Kunstgeschichte. Die Bauform birgt Potential für gesellschaftliche Veränderungen
Bei Gedanken an aufblasbare Architektur kommen mir zunächst Hüpfburgen in den Sinn. Haben die etwas mit deinem Thema zu tun?
Das ist vermutlich das Objekt, an das alle erstmal denken – das war bei meinen Dozentinnen auch nicht anders. Man kann Hüpfburgen durchaus unter einem architektonischen Aspekt beurteilen: insofern, als dass es eine konkrete Raumnutzung mit einer Form gibt, die auf die Funktion abgestimmt ist. Die Intentionen der Architekten, die mit aufblasbarer Architektur in den öffentlichen Raum gegangen sind, waren aber andere. Es ging darum, durch ihre aufblasbaren Konstruktionen die Frage aufzuwerfen, was und wie eine Stadt eigentlich sein soll und somit Kritik am Mainstream der Architektur zu äußern. Häufig sind es aber vor allem Kinder, die mit großen Augen vor pneumatischer Architektur stehen bleiben.
Was genau ist pneumatische Architektur?
Pneumatische Architekturen gehen auf ein ganz einfaches Konstruktionsprinzip zurück: Sie sind aufblasbare Räume, die aus einer textilen Membran bestehen. Wie ein Ballon behalten sie ihre Form nicht durch feste Elemente, sondern durch einen erhöhten Innendruck, der die Haut spannt. Bei größeren Räumen, in denen sich auch Personen aufhalten, muss meistens durch ein Gebläse eine ständige Luftzufuhr gewährleistet sein.
Warum ist die Membran bei vielen Arbeiten durchsichtig?
Ich denke ein Grund dafür ist, dass man die Idee einer minimalen Raumhülle erforscht hat: Was ist das absolute Minimum an Material, das man braucht, um eine architektonische Situation zu schaffen? Es geht darum, weg von Objekten zu kommen und hin zu Situationen. Es geht darum, wie Menschen in diesem Raum interagieren.
Wie bist du zu deinem Thema gekommen?
Das Seminarthema war „Art as social intervention“ und fand im Rahmen des Exzellenzclusters Asia and Europe statt. Ich war der einzige Kunsthistoriker in dem Seminar. Das war für mich eine spannende Erfahrung: dass Leute aus anderen Fachbereichen auch wichtige Sachen zu künstlerischen Themen zu sagen haben. Die Dozentinnen haben mich ermutigt interdisziplinär zu denken. Ich kannte aufblasbare Architektur schon ein bisschen, in der neueren Architekturgeschichte, etwa ab den 50ern, kommt sie zwar immer wieder vor, allerdings nur als Randerscheinung.
In deiner Arbeit wird der Heidelberger Raumfänger, ein portabler Ballon von der Größe eines kleinen Klassenzimmers, aufgegriffen. Hat dich dieses Beispiel zu deiner Arbeit inspiriert?
Tatsächlich war es Zufall, dass ich über den Raumfänger am Uniplatz gestolpert bin. Ich war schon mittendrin, die Arbeit zu schreiben und hatte mich viel damit auseinandergesetzt, was vor 30, 40 Jahren war. Den Raumfänger so plötzlich vor mir zu sehen, hat mir die Möglichkeit gegeben, gewisse Dinge zu reflektieren, da ich selbst erlebt habe, was es mit mir macht, im alltäglichen Stadtbild auf einmal solch ein Objekt zu sehen und zu betreten.
Was hat sich denn im Vergleich zu früher verändert?
In den ausgehenden 60ern gab es noch viel staatliche Stadtplanung, die stark kontrolliert wurde und inflexibel war. Heute hingegen wird die Stadt immer stärker privatisiert. Ein zweiter Punkt ist die Bedeutung von Spaß im öffentlichen Raum. Es war damals nicht üblich, in Diskurse wie dem Städtebau den Aspekt des Spaßes einzubringen. Öffentlich Spaß zu haben war deshalb fast schon Teil einer alternativen Kultur. Heute hingegen spricht man regelrecht von einer Spaßgesellschaft. In den aktuellen Interventionen geht es nicht mehr nur darum, den öffentlichen Raum aufzumischen, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg verschiedenen Akteuren einen Raum zu geben.
Werden Menschen künftig in aufblasbaren Räumen wohnen können?
Ich glaube, dieses Bausystem eignet sich nur begrenzt zum Wohnen. Das hängt auch am Klima innerhalb der Hülle. Man muss darüber nachdenken, wie frische Luft in dem Gebäude bestehen bleibt. Eine Ausnahme ist ein Projekt von Michael Rakowitz. Er hat in New York aufblasbare Hüllen an Lüftungen von Gebäuden angeschlossen. Darin konnten dann Obdachlose schlafen.
Das zeigt den Gegensatz zwischen neueren Formen und den aktionistischen Projekten der 60er: Es geht nicht nur darum ein Problem aufzuzeigen, sondern auch eine Lösung anzubieten.
Das Gespräch führte Alexandra Koball.