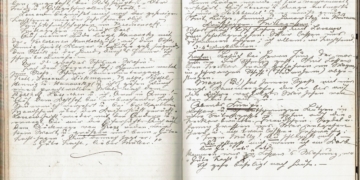Klaus Schirdewahn (72) setzt sich seit Jahren für den offenen Umgang mit Homosexualität ein und unterstützt vor allem ältere Menschen, die in ihrer Jugend wegen ihrer Sexualität unterdrückt wurden.
In den vergangenen Jahren fand eine Welle der Solidarität mit Schwulen und Lesben statt. Das war nicht immer so. Herr Schirdewahn, wie war der gesellschaftliche Umgang mit Homosexualität in ihrer Jugend?
Ich bin 1947 geboren. Damals war gleichgeschlechtliche Liebe illegal. Wenn man sich mit Gleichgesinnten treffen wollte, musste man in bestimmte Kneipen oder Schwimmbäder gehen. Das war aber immer riskant. Wenn man erwischt wurde, drohte einem Gefängnis. Einmal wurde ich zusammen mit einem anderen Mann entdeckt. Man hat mich verhaftet und vor die Wahl gestellt, ob ich ins Gefängnis gehe oder eine „Therapie“ mache, die mich wieder „reparieren“ sollte. Ich habe mich für die Therapie entschieden – damals dachte ich noch, das wäre die bessere Wahl. Aber als jemand, der aus einer religiösen Familie kommt, begann ich irgendwann selbst zu glauben, dass etwas mit mir nicht stimmt.
Wie waren denn Ihre Erfahrungen in der Ausbildung?
Bei der Arbeit durfte das natürlich niemand wissen. Wäre das rausgekommen, hätte ich meine Stelle verloren. Ich war aber auch eigentlich ganz gut darin, das zu verstecken. Man musste vor den älteren Mitarbeitern dabei genauso auf der Hut sein, wie vor den jüngeren. Manche stellen sich das heute wie eine Einstellung vor, an dem vor allem die konservativen Älteren festgehalten haben, aber es war eine Straftat. Es war völlig egal, wer einen erwischt. Auch Gleichgesinnte zu identifizieren war äußerst schwierig. Wenn man falsch lag, konnte das schwere Konsequenzen haben. Manchmal haben wir Parties veranstaltet, zu denen wir lesbische Paare eingeladen haben, damit es für die Nachbarn nicht so aussah, als wären wir nur Männer. Das waren unsere Anstandsdamen (lacht).
Gibt es etwas, von dem Sie sich wünschen, dass es mehr Leute heute wüssten?
Junge Leute können heute größtenteils frei leben und brauchen sich wegen ihrer Sexualität keine Sorgen zu machen. Zumindest hat es den Anschein. Aber es gibt immer noch Menschen in meinem Alter, die mit sich hadern. Manche von ihnen glauben bis heute, mit ihnen sei etwas verkehrt. Für solche Menschen müssen wir sichere Räume schaffen.
Nimo (21) studiert Biologie und Geografie und engagiert sich im Queerreferat. Im wirklichen Leben heißt der*die Student*in anders, möchte hier aber anonym bleiben.
Du warst ein Jahr lang Referent*in im Heidelberger Studierendenrat. Was bedeutet politischer Aktivismus für dich?
Ich bin nicht-binär, deswegen liegt mir queerer Aktivismus im Referat und auch im Alltag sehr am Herzen. Wir haben in Heidelberg Glück, weil es hier viele Menschen gibt, die sich engagieren wollen. Es gibt einiges wie den CSD, Dyke March und Lady*Fest in der ganzen Rhein-Neckar Region. Oder zum Beispiel das QueerFestival, das war das erste Festival dieser Art in Deutschland. In Heidelberg! Im kleinen, schönen Heidelberg. Und es wird jedes Jahr größer. Da steckt so viel Arbeit dahinter und eigentlich kann man sich nie zurücklehnen.
Vor ein paar Wochen fanden die Trans*Aktionswochen in Heidelberg und Umgebung statt. Die Veranstaltungen standen unter dem Motto Empowerment – was verstehst du darunter?
Empowerment bedeutet für mich, eine Situation zu nehmen und mit den Gegebenheiten, die es dabei gibt, das Beste daraus zu machen. Wenn mir es möglichst gut geht, habe ich auch Energie eine Situation zum besseren zu wenden.
Was müsste sich ändern?
In Bezug auf die Uni ist eine Eintragsänderung von Namen oder Geschlecht super schwierig. Auch eine vollständige Namens- und Personenstandsänderung ist sehr aufwändig. Man braucht ein Gutachten, das kostet Geld, das akzeptiert die Uni. Aber es gibt auch den Ergänzungsausweis, den akzeptiert die Uni nur manchmal. Generell der Umgang der Krankenkassen ist fürchterlich. Man muss zwangsweise in Therapie gehen, was Trans*-Sein sofort pathologisiert. Je nach „Diagnose“, kann man nur bestimmte Dinge erstattet bekommen. Das soll sich 2022 ändern, das ist viel zu spät. Und diese strukturellen Hürden schlagen sich in der Gesellschaft nieder. Trotzdem, man darf sich daran nicht selbst kaputtmachen. Man muss nachhaltig sein mit seinem Aktivismus, sonst brennt man irgendwann aus.
Wie kann man dieser gesellschaftlichen Ignoranz entgegenwirken?
Es gibt ein Defizit, was den Stand des Allgemeinwissens der Bevölkerung angeht. Ich habe oft gesagt, ich bin im Queerreferat und wurde gefragt: „Was ist quer?“ Ein paar Grundbegriffe sollte man kennen, ich würde mir wünschen, dass ich nicht immer die Enzyklopädie spielen muss. Eigentlich ist es im Studium schon zu spät, Leuten so ein Grundwissen beizubringen. Da läuft definitiv etwas falsch, aber deshalb leisten wir auch Bildungsarbeit.
Von Svenja Schlicht und Nele Bianga
Svenja Schlicht machte im Sommer 2020 ihren Bachelor in Politikwissenschaft und Ethnologie an der Uni Heidelberg. Von Februar 2020 bis August 2020 leitete Sie das Feuilleton. Theater und Kultureinrichtungen waren aber bereits seit Oktober 2019 vor der ruprecht-Redakteurin nicht mehr sicher. Jetzt studiert sie an der Kölner Journalistenschule und freie Journalistin.