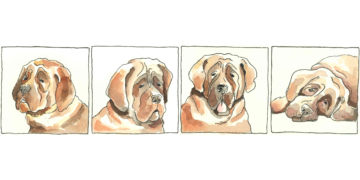Wir befinden uns in einer Krise. Es kriselt sozusagen und nicht nur sozusagen, sondern ganz real. In Zeiten der Krise befinden wir uns in einer Krise und zum Wir gehöre auch ich und auf Neudeutsch frage ich mich: Diese Krise, was macht die mit dir? Tja, was macht sie mit mir?
„Davon werden wir noch unseren Kindern erzählen und Enkeln und Haustieren“ hört man, und: „diese Krise geht in die Geschichtsbücher ein“. In meinem Geschichts-LK behandelten wir die Krisen der Römischen Republik. Da war im Buch ein Graph mit einer Kurve eingezeichnet und die Krise stellte den Wendepunkt dar. Den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung. Die Krise als Zeit der Gefährdung, des Gefährdetseins. Synonyme: Ausweglosigkeit, Dilemma, Misere, Zwangslage. Mir scheint, es gibt Schöneres. So schien es den Römern auch, habe ich gelernt, damals im Geschichts-LK. Wir schreiben Geschichte. In dieser Krise. Ist doch alles immer irgendwie Geschichte. Mein Käsebrot von gestern Abend – längst Geschichte. Dabei esse ich gar keinen Käse, aber Hummusbrot klingt nicht so gut. Gibt es da ein Kategoriensystem, das die aufregende von der langweiligen Geschichte trennt? Bin ich aufgeregt? Und was ist eigentlich mit der Klimakrise? Ausgesetzt? Aufgehoben? Abbestellt?
Ich habe bereits eine Krise, auf die sich die Mehrheit der Menschen als Krise einigen konnte, miterlebt. Die Weltwirtschaftskrise 2008/2009. Aber da war ich noch viel zu jung, um etwas zu begreifen. Begreife ich denn jetzt etwas? Ich war in jedem Fall zu jung, um zu versuchen, etwas zu begreifen. Ich frage Mama und Papa: „Wie war das denn? In der Krise?“ Die sagen: Verrückt war das. Mit den Banken. Und großer Aufruhr. Aber anders als jetzt.
Ich habe ein paar neue Vokabeln in meinem Wortschatz, die gar nicht neu sind. Doch sie fühlen sich so an, denn ihre Bedeutung wurde verschoben. Gesund. Positiv. System. Risiko. Krise. Ich kannte das Wort Krise auch vor Mitte März 2020, habe es sicher oft benutzt. Ich krieg‘ die Krise. Jetzt lebe ich in einer.
Dinge, die ich habe: ein gutes Immunsystem. Einen Wald direkt vor der Tür. Ersparnisse, mit denen ich, auch wenn ich gerade nicht arbeiten kann, erst einmal über die Runden komme. Eltern, die nicht in der freien Wirtschaft tätig sind. Großes Glück in der Lotterie des Lebens.
Dinge, die ich nicht habe: Menschen mit Vorerkrankungen in meinem Umkreis. Kinder, um die ich mich parallel zur x-ten Videokonferenz kümmern muss. Sorge um die finanzielle Existenz. Angst um mein eigenes Leben.
Diese Krise, was macht sie mit mir? Sie lehrt mich Demut und Dankbarkeit.
Wenn ich spazieren gehe und den obligatorischen Bogen um mir entgegenkommende KrisengenossInnen mache, nickt man sich kurz zu. Einige gehen sogar bis zum Äußersten und lächeln zurück. Das ist dann schön. Man weiß ja. Man versteht sich. Man zieht den Bogen nicht, weil das Gegenüber schlecht riecht oder so. Ist jedenfalls nicht der primäre Grund. You are not alone. Sind wir solidarischer, netter geworden in der Krise? Oder gehe ich einfach nur häufiger spazieren? Vermutlich Letzteres. Wäre auch zu gut gewesen. Denn der sehr breitbeinig laufende Macho (man kennt ihn) schafft es auch in Krisenzeiten nicht, mir sehr breitbeinig einen Meter nach links auszuweichen oder halt nach rechts. Da gilt: lächeln. Eine Gesellschaft misst sich schließlich an ihrem Umgang mit den schwächsten Gliedern, deren Glieder scheinbar einer gewissen Breitbeinigkeit beim Laufen bedürfen. Rücksicht ist ja das Gebot der Stunde. Jaja.
Und was hilft stets, wenn sonst nichts hilft? Die gute alte Hoffnung. An die klammern wir uns. Machen Pläne für „wenn das alles vorbei ist“. Dann wollen wir den ganzen Tag im Café verbringen und Feste feiern und schwimmen gehen. Dann. Wann ist dann? Wir glauben an die Hoffnung, denn was bleibt schon anderes übrig. Und vielleicht ist sie es, die uns in dieser Krise zusammenhält. Die Hoffnung als kleinster gemeinsamer Nenner, der in echt gar nicht so klein ist. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, und so. Kennt man ja. So leben wir gemeinsam und doch allein in und mit dieser Krise. Vereint in der Hoffnung auf ihr Ende.
Von Nele Karsten
Nele Karsten studiert Politikwissenschaft und Psychologie. Für den ruprecht schreibt sie seit 2019 über aktuelle Phänomene wie den Klimawandel und deren Auswirkungen. In ihren Glossen zeigt sie sich gesellschaftskritisch und geht dabei gern bis an die zynisch-sarkastische Schmerzgrenze.