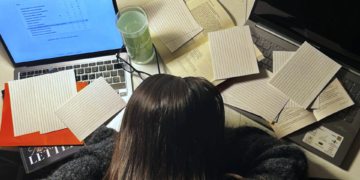Dieser Artikel erscheint im Rahmen unser Corona-Onlineausgabe.
Ende März noch sagte der schwedische Staatsepidemiologe Anders Tegnell: „Das schwedische Modell funktioniert. Ich bin mir sicher, wir werden genauso erfolgreich sein wie andere Länder auch“. Genau dieses „schwedische Modell“ ist es, das seit einigen Wochen die internationale Gemeinschaft dazu veranlasst, ihre Aufmerksamkeit mit einer Mischung aus Neugierde und Misstrauen auf Schweden zu richten. Wissen die etwas, was alle anderen nicht wissen? Und was genau ist eigentlich das „schwedische Modell“?
Auf staatlicher Ebene ist damit die Verschiebung von Handlungskompetenzen an Verwaltungsbehörden gemeint. Bei dieser für Schweden gängigen Praxis sind es also nicht primär verbindliche Gesetze, sondern Empfehlungen des schwedischen Gesundheitsamtes, die in der Krise den Weg weisen: Hände waschen, Home-Office und Kontaktbegrenzung, bei Krankheit zu Hause bleiben. Die einzigen verbindlichen Regeln sind die Versammlungseinschränkung auf 50 Personen und das Verbot von Gedränge in der Öffentlichkeit, der Einreise nach Schweden und Besuchen in Altenheimen. Hinter dieser Strategie liegt der schwedische Glaube daran, dass Informierung und Appelle an Solidarität und „Volksverstand“ in einer freien, gleichen und demokratischen Gesellschaft weiter reichen als Zwang. Empfehlen statt verordnen, erklären statt verbieten und Expertenorientierung statt Politik.Nicht zu Unrecht drängt sich vielen allerdings die Frage auf, wie das praktisch funktionieren soll.

Wenn ich durch Stockholm laufe, stelle ich mir manchmal die Frage, ob ich eigentlich merken würde, dass eine weltweite Pandemie herrscht, wenn ich es nicht wüsste. Die Antwort darauf: unklar. Verglichen mit Bildern von menschenleeren Straßen und geschlossenen Cafés in Deutschland, erscheinen manche Stadtteile hier wie das Epizentrum einer Völkerwanderung. Gerade an diesen ersten Frühlingstagen, zeigt das Fernsehen oft Reportagen von gefüllten Parks mit unbesorgten Picknick-Gesellschaften und Sportgruppen. Ohne die vielen Plakate mit Aufforderungen, Abstand zu halten und auf Bus und Bahn zu verzichten, würde man kaum einen Unterschied merken.
Gleichzeitig hat sich auch vieles verändert. Ja, es sind mehr Menschen auf den Straßen als in anderen Ländern – aber weitaus weniger als sonst. Meine Freunde, die in Schweden studieren, besuchen Online-Kurse und haben sich weitestgehend in Selbstquarantäne versetzt. Andere sind in Kurzarbeit geschickt worden – ein Zeichen dafür, dass auch hier Gastronomie, Geschäfte und Betriebe unter der Abwesenheit ihrer Kunden leiden. Wenn man sich überhaupt trifft, dann auf Zwei-Meter-Abstand-Spaziergängen im Freien. Dass die Empfehlungen des Gesundheitsamtes einen Effekt haben, zeigen auch Umfragen, wonach 93 Prozent der Befragten ihre sozialen Kontakte eingeschränkt haben.

In Schweden ist das Vertrauen in Regierung und Gesundheitsämter groß. Die kritischen Stimmen kommen vor allem aus Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, deren unzureichende Schutzausrüstung und geringe Testkapazität zumindest zu Beginn der Ausbreitung Protest hervorgerufen haben. Trotzdem ist man mit der schwedischen Strategie weitestgehend zufrieden – ein Gefühl, dass gerade angesichts der schrittweisen Öffnung und Angleichung in anderen Ländern verstärkt wird. Dennoch: so wie in anderen Ländern weiß auch hier niemand, was am Ende die beste Strategie gewesen sein wird. Der schwedische Plan fußt auf der Hoffnung, die jetzigen Bestimmungen langfristig aufrechterhalten zu können, die Ansteckung zu verzögern und gleichzeitig eine breite Immunität in der Bevölkerung herzustellen. Der direkte Zahlenvergleich mit anderen Ländern ist erst dann sinnvoll, wenn auch dort die Restriktionen gelockert worden sind. Das schwedische Modell bietet eine Alternative zu dem herkömmlichen Kurs, in der den Freiheiten der Menschen mehr Raum gegeben wird. Was unterm Strich dabei herauskommt, das weiß keiner. Klar ist aber, dass das Testen verschiedener Strategien notwendig ist, um die richtige zu finden.
Von Marit Braunschweig