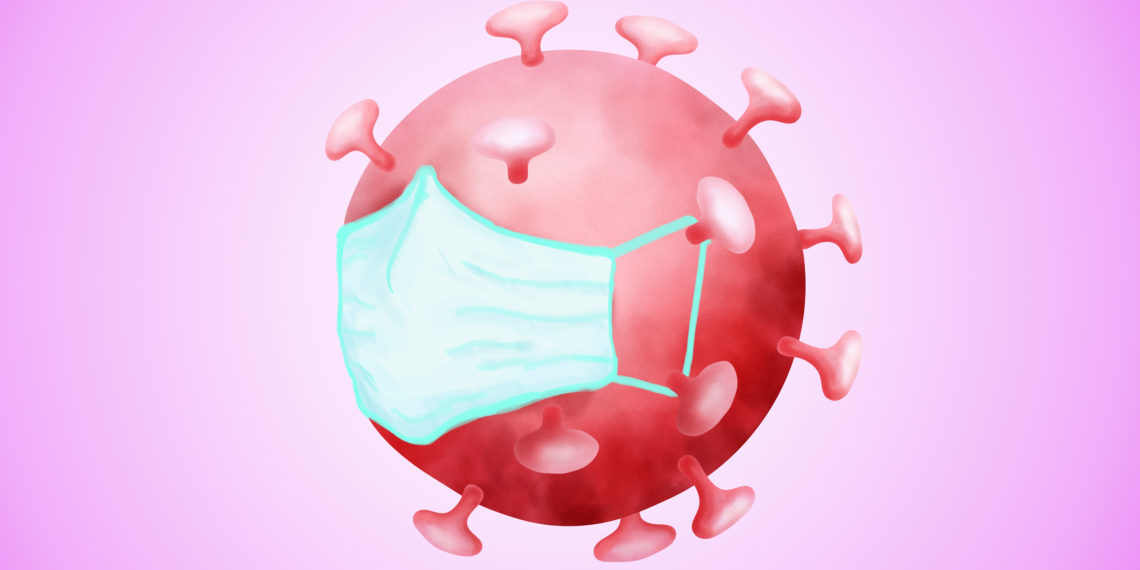Zeitungsmeldungen werden von Bildern begleitet. Das ist Tradition und so brachte die Corona-Pandemie eine Flut von Bildern zum Thema, deren Mehrzahl eines gemeinsam hat: Sie zeigen nicht viel.
Es gibt Fotos von Atemmasken. Massenhaft Mund-Nasen-Schutz, denn das ist ein einfach zu beschaffendes Requisit, welches sich zu verschiedensten Kompositionen arrangieren lässt. Da wären Schreibtische mit Computern drauf. Die perfekte Illustration zu Homeoffice und Online-Lehre. Handys mit geöffneter Corona-App.
Nun sind das alles gestellte Bilder, die der Illustration und dem Anlocken von Lesern dienen. Daneben entstehen dokumentarische Aufnahmen. Leere Städte. Ein menschenleerer Mailänder Domplatz und später ein Lazarettschiff vor Manhattan. Die Bilder von Militärkonvois, welche Tote aus dem schwer getroffenen Bergamo transportierten, waren ein Schock und eine Ausnahme, denn sie zeigten das Ausmaß der kommenden Katastrophe in aller Eindringlichkeit.
Aktuell zeigt mir ein Besuch der Webseiten von Spiegel und Süddeutscher Zeitung folgende Corona-Illustrationen: 14 Symbolbilder, 18 Nebenschauplätze der Pandemie (Demos, Unterricht mit Mundschutz, Pressekonferenzen) und ein Foto einer Genesenen, die im Interview von ihrer Krankheit erzählt.
Von wenigen Ausnahmen abgesehen wird in der Berichterstattung nicht die Krankheit gezeigt.
Natürlich muss auch über Nebenschauplätze berichtet werden. Doch es ist verlockend einfach, Atemmasken, leere Straßen und verschlossene Club-Türen zu fotografieren. Es ist einfacher, auf der „Querdenker“-Demo „Covidioten“ in Schwarz-Weiß-Rot zu fotografieren, als sich langwierig und mühevoll Zugang zu einer Corona-Station zu schaffen und dort Vertrauen zu gewinnen.
Das Ergebnis: Wir zeigen nicht den Kern den Pandemie. Wir zeigen nicht den Tod, sondern alles, was darum herum geschieht.
Zugleich erkranken immer mehr Menschen und die Kranken sterben einsam. Sie vegetieren auf Isolierstationen, alleine und oft ohne Möglichkeit, ihre Familien zu sehen und sich von ihnen zu verabschieden. Bis ihre Körper versagen und ihre infektiösen Leichen fortgeschafft werden.
Das sehen die wenigsten und was nicht gesehen wird, existiert gefühlt kaum. Statt dessen werden Krankheit und Tod zu Zahlen, doch Zahlen sind abstrakt und lassen sich leichter relativieren als ein Leichenhaufen. Von 17 Corona-Toten in Heidelberg zu lesen ist eine Sache, 17 Leichen zu sehen eine andere.
Bilder haben das Potential, die emotionale Lücke zu schließen, die von der Statistik offen gelassen wird. Sie können das Leid, das Grauen und den Tod zeigen. Das erfordert harte Arbeit an einem Ort, wo man nicht erwünscht ist, doch es ist möglich und notwendig, menschlich an die Kranken heranzutreten, die Menschen im Angesicht des Unmenschlichen zu zeigen und Mitgefühl zu wecken.
Doch es geschieht zu selten. Schade.
von Nicolaus Niebylski
Nicolaus Niebylski studiert Biowissenschaften. Beim ruprecht ist er seit dem Sommersemester 2017 tätig – meist als Fotograf. Er bevorzugt Reportagefotografie und schreibt über Entwicklungen in Gesellschaft, Kunst und Technik. Seit November 2022 leitet er das Ressort Heidelberg. Zuvor war er, beginnend 2019, für die Ressorts Studentisches Leben, PR & Social Media und die Letzte zuständig, die Satireseite des ruprecht.