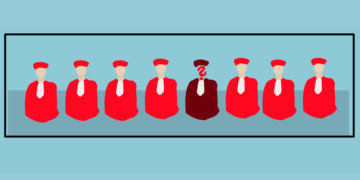Es ist März, erste Sonnenstrahlen machen sich bemerkbar und die Temperaturen klettern langsam wieder Richtung wohlig warm. Nach einem langen Winter wird Heidelberg neues Leben eingehaucht. Überfüllte Neckarwiesen und lange Schlangen vor den Eisdielen stehen an der Tagesordnung. Und trotz der allgegenwärtigen Pandemie kann den ein oder anderen eine Beschwingtheit erfassen. Nennen wir sie Frühlingsgefühle.
So wollen wir uns in dieser Ausgabe einem eher locker leichten Thema widmen. Um nicht im Kitsch zu versinken, stellt sich unsere Redaktion erneut eine konkrete Frage: Macht Liebe blind? Unsere Autoren argumentieren aus einer persönlichen, philosophischen, psychologischen und zu guter Letzt aus einer biologischen Perspektive, was es mit der Liebe und verlorenen Sehkraft auf sich hat.
Blind wie ein Maulwurf

Mit sechs bekam ich meine erste Brille. Danach ging es, zumindest was mein Augenlicht betraf, nur noch Berg ab: minus fünf, minus sechs und zuletzt minus sieben Dioptrien. Das kommt dem Blind-Sein schon sehr nahe. Trotzdem kann ich dem etwas Gutes abgewinnen. Wenn ich die Brille absetzte, mich nach draußen begebe und mir ein paar Minuten Zeit nehme, eröffnet sich mir eine ganz andere Welt. Auf einmal wird es unwichtig, alles um mich herum zu sehen — was ich höre, rieche, fühle, das ist Wirklichkeit. Und zwar eine viel Deutlichere, als ich sie hätte jemals sehen können.
Verliebt-Sein heißt Überwältigt-Sein, nicht nur von Gefühlen. Es sind eher die Gedanken, die verrückt spielen. Sich immer wieder im Kreis drehen und um eine Person tanzen. Dann kommt die Aufregung. Wie Lawinen wird sie durch kleinsten Ereignisse ausgelöst: ein Gedanke, eine Erinnerung, ein Blick. Die Aufregung, sie nimmt mich komplett ein, mein Atem wird flacher und ich beginne innerlich zu zittern. Manchmal bin ich wie im Rausch, verliere jeden Bezug zu Zeit und Ort.
Obwohl meine Gedanken überall sind, nur nicht bei mir, bin ich selten selbstversunkener. Ich bin überwältigt von allem, was sich in mir abspielt. Und diese Überforderung macht mich „blind“. Für meine Umgebung und manchmal sogar für mein Gegenüber.
Dann vergeht ein wenig Zeit. Ich nehme mir Zeit, wir nehmen uns Zeit. Manchmal wird aus dem Verliebt-Sein schließlich Liebe. Meine Gedanken kreisen weniger und weniger, bis sie sich in einem gelegentlichen Taumeln verlaufen. Ab und an bereiten sie mir Kopfschmerzen. Der Andere hat nun mal seine Macken. Dennoch, ein wenig Aufregung bleibt und mein Atem wird sicher noch häufiger flacher. Auch der Rausch klingt nicht gänzlich ab — er wird nur altbekannt.
In der deutlich klareren Benommenheit verschwindet die Versunkenheit. Und ich erkenne, dass ich gerade ein wenig blind bin. Dass sich ein schlechter Filter über die Realität gelegt hat. Er sie hier ein wenig verschleiert, um sie da umso mehr zum Strahlen zu bringen. Meine Wirklichkeit entpuppt sich als geformt. Schemenhaft sehe ich, was ich sehen sollte. Denn: Realität ist nicht relativ, meine Wirklichkeit schon. Was jetzt? Ich weiß es nicht. Doch was ich weiß: Ob nun mit oder ohne Liebe — wir sehen alle anders „blind“. Und ich? Fast so gut wie mit minus sieben Dioptrien.
von Sarah Ellwardt
Die Liebe — eine ultimative Brille?

Meist tragen wir unsere Rationalitätsbrille. Sie ermöglicht uns das Überleben in der alltäglichen Welt. Durch sie können wir scharf sehen, das Relevante erkennen und daraus vernünftige Schlüsse ziehen. Das funktioniert. Zumindest bis die Liebe ins Spiel kommt. Im Rausch der wohl schönsten Gefühle legen wir unsere Rationalitätsbrille ab. Besser: sie wird uns ruckartig entrissen. Um die Leere auf unserer Nase zu füllen, überkommt uns der Drang, ein rosarotes Nasenfahrrad aufzuziehen. Leider erfüllt es aber nicht die übliche Funktion einer Sehhilfe. Vielmehr wirkt die Welt durch die rosarote Brille verschwommen. Im Liebesrausch ziehen wir dann unvernünftige Schlüsse. Nicht selten wird das Tragen der rosaroten Brille auch als temporärer Zustand der Verrücktheit beschrieben. Gewissermaßen macht Liebe blind. Oder?
Liebe als Fundament
Nein, Liebe macht nicht blind. Sie macht viel mehr! So (oder so ähnlich) hätte Max Ferdinand Scheler auf diese Frage geantwortet. Scheler war ein deutscher Philosoph, Soziologe und Anthropologe. Er wurde 1874 in München geboren und starb im Jahre 1928 in Frankfurt am Main. In der Zwischenzeit widmete sich Scheler verschiedensten Themen – darunter Krieg, Religion und der Liebe.
Liebe ist für Scheler mehr als eine dysfunktionale, rosarote Sehhilfe. Für den Münchner Philosophen führt sie nicht zu einem Herumirren in der weiten Welt. Liebe ist für Scheler die Grundlage des menschlichen Daseins. Der Mensch ist ein „ens amans“ – ein liebendes Wesen. Die Liebe lässt den Menschen in die weite Welt streben. Sie ist der tiefste Treiber unseres Handelns.
Bevor wir aber handeln, müssen wir die Welt erkennen. Für Scheler können wir das mit einem Blick auf oder in ein geliebtes Gegenüber. Die Liebende erkennt erst in der geliebten Person die Fülle an Möglichkeiten, die die Welt offenbart. Der Mensch entdeckt die zahlreichen Chancen, über sich hinauszuwachsen. Die Liebe ist also erst die Brille, die uns die Welt, ihre Potentiale und damit unseren Platz in ihr aufzeigt. Sie weist uns den Weg zum „Schönen“ an sich.
Die rosarote Brille folgt aus einer Form der Liebe
Führt der Mensch laut Scheler aber zwingend ein solches Leben? Bewegt sich der Mensch immer zum Schönen? Nein, der Mensch kann auch eine unpraktische rosarote Brille tragen. Lässt sich ein Mensch im Liebesrausch nur von Affekten und Trieben leiten, kann er die Welt und ihre Potentiale nicht adäquat erkennen. Die Möglichkeit, sich selbst zu übersteigen, besteht in diesem lustgetriebenen Zustand nicht. Diese bestehe erst, wenn das lüsterne Streben aus einer inneren, leidenschaftlichen Anziehung folgt – aus der Liebe. Liebe macht nicht blind. Sie lässt uns erst wirklich sehen.
von Aaron Löffler
Überdosis Hormoncocktail
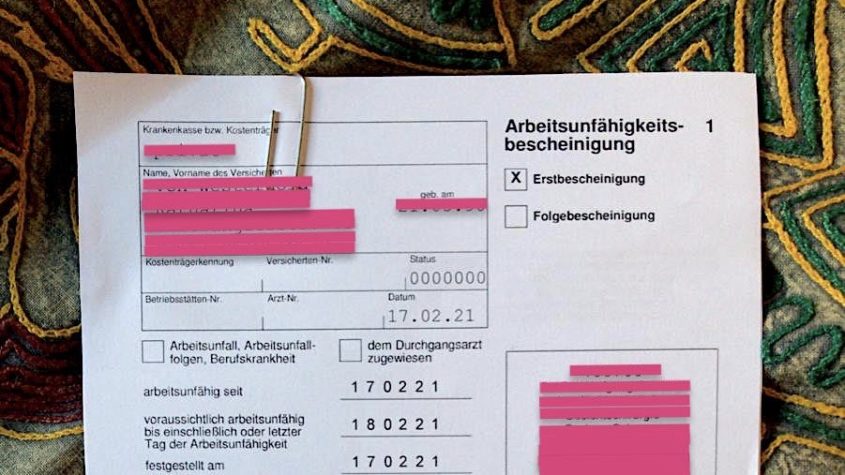
Ein ärztliches Attest über eine akute Sehschwäche. Befund: Verliebt sein. Nichts, was einem Prüfungsamt je vorgelegt worden ist. Wäre das jedoch ein valider Grund? Vielleicht. Auch biologisch gesehen, macht Liebe nämlich ein bisschen blind.
Ist man verliebt, passieren verschiedene Dinge im Körper — besonders im Gehirn. Steht man in Kontakt mit der Person, für die man Gefühle entwickelt hat, werden die „Glückshormone“ Dopamin und Serotonin ausgeschüttet. Letzteres ist unter anderem Verursacher des bekannten „Rollercoaster-ride“-Gefühls, das Verliebte umtreibt. Alles ist toll, wenn DIE Person da ist, alles schrecklich, wenn nicht.
Ein weiteres Hormon, Oxytocin, spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle. Es stärkt zwischenmenschliche Beziehungen. Darunter fallen Mutter-Kind-Beziehungen, aber auch Paarbeziehungen zwischen Geschlechtspartnern. Es wird bei Austausch von Zärtlichkeiten und Orgasmen ausgeschüttet. Auf diese Weise beeinflusst es Paarbindungen auf lange Frist. Seine Wirkung folgt einem einfachen Prinzip: Je mehr Oxytocin, desto loyaler und nachsichtiger ist man.
Warum passiert das überhaupt alles? Der Hormon-Cocktail aktiviert ein Belohnungssystem, das unsere Sexlust anregt. Biologisch ist das sinnvoll. Problematisch ist nur, dass durch die Aktivierung von Belohnungssystemen, andere Hirnareale runtergefahren werden müssen. Viele davon sind beim Treffen rationaler Entscheidungen jedoch essentiell. Liebe macht also tatsächlich ein bisschen (Entscheidungs)-blind.
Dieser Prozess ist bei jedem sehr individuell und schwer messbar, weswegen ein Attest wegen Verliebtseins nicht in Aussicht steht. Dass man sich aber etwas komisch fühlt, ist biologisch belegbar. Es ist völlig normal und Fluch und Segen zugleich (is it the Serotin speaking?).
Manchen Wissenschaftlern zufolge, macht Liebe nicht „blind“, aber sehr wohl schummrig vor Augen — ähnlich wie nach einer drogenintensiven Clubnacht. Sie behaupten nämlich, dass Liebe ähnliches im Körper auslöst wie ein Dauer-High. Mit fatalem Suchtpotential. Nur dass Verliebte hier süchtig nach einer Person sind.
In diesem verliebten Zustand werden nicht unerhebliche Mengen Adrenalin ausgeschüttet. Das hat auch wieder individuell unterschiedliche Folgen. Allgemein bekannt ist Adrenalin als Stresshormon, was z.B. Herzrasen auslöst. Ein besonders unangenehmes Symptom, wenn man sich gerade besonders konzentrieren möchte, gut rüberzukommen. Adrenalin ist also nicht der Grund für die rosarote Brille. Das Hormon gibt einem aber das Gefühl, alles ein wenig verschwommen zu sehen. Eine Lösung des Problems hat die Natur aber auch gleich mitgeliefert. Egal wie sehr das Adrenalin stresst: Küssen baut konsequent Stress ab. Je mehr, desto besser.
von Emeli Röttgers
Doch alles nur Kopfsache?

Weniger Stress ist gut für die Psyche — genauso wie Liebe. Wenn wir für jemanden schwärmen, beginnen wir uns zu manipulieren. Der Mensch hat die Tendenz dazu, Sachen und Menschen zu idealisieren.
Man nehme zum Beispiel den Kauf eines Autos. Findet man ein Modell von Anfang an schick, führt das häufig dazu, dass man die Anzeigen für gleichwertige Autos nur überfliegt oder ganz unter den Tisch fallen lässt. Oft ignoriert man bessere Angebote, besonders, wenn man schon viel Zeit in den Kaufprozess investiert hat. Ähnlich bei Liebhabern. Die Psychologie zeigt, dass Verliebte geflissentlich negative oder nervende Charakterzüge am Gegenüber übergehen, wenn sie es für attraktiv oder interessant genug befinden. Dabei nehmen sie die positiven Aspekte des Anderen umso mehr wahr. Psychologisch macht Liebe also nicht blind, denn Verliebte sehen die Vorzüge des Anderen vollkommen klar. Es kommt eher zu einer Art selektivem Sehen. Positives ist scharf, Negatives unscharf.
Lässt sich dieses Phänomen erklären? Es wird auf jeden Fall versucht. Das selektive Sehen kann helfen, Verteidigungsmechanismen zu durchbrechen. Lässt man sich auf jemanden ein, findet vorher eine Art innere Debatte statt. Man versucht vor sich selber zu begründen, wieso man sich jetzt genau dieser Person emotional öffnet und schließlich sexuell hingibt. Das begründet man natürlich am besten auf der Basis von rein positiven Aspekten.
Vorstellen kann man sich diese Debatte wie ein „Gänseblümchen-zupfen“:. „Sie liebt mich, sie liebt mich nicht…“. Wenn nicht jedes zweite, sondern nur jedes fünfte Blütenblatt ein „Sie liebt mich nicht“-Blatt ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das gezupfte Gänseblümchen am Ende ein positives Ergebnis verheißt. Durch das selektive Sehen, hat man einfach mehr positive Argumente in der inneren Debatte zur Hand. Deswegen meine These: Gäbe es das selektive Sehen nicht, gäbe es weniger Sex und weniger Partnerschaften.
Also ‚worth it‘? Naja. Mit einer einseitig vorbereiteten Debatte kann man bekanntlich auf die Nase fallen. „Wie konnte ich so blind sein“, fällt gerne, wenn große Contra-Punkte erst später klar werden. Zu viele Augen zudrücken, auf einem Auge blind gewesen sein – alles Redewendungen, die aus gutem Grund existieren. Es fühlt sich nicht gut an, wenn man sich in jemandem getäuscht hat. Ein wenig helfen Falscheinschätzungen jedoch auch, denn es ist wie Medizin gegen das selektive Sehen. Es hilft, in Zukunft negative Aspekte, „red flags“, schneller wahrzunehmen.
Durch Erfahrung wird die Sicht also ein wenig klarer. Ganz weg geht die Semi-Blindheit aber eigentlich nicht. Ein Glück! Wäre ja schade, wenn der psychische Verteidigungsmechanismus nicht mehr durchbrochen werden könnte und wir uns auf niemanden mehr emotional einlassen. Psychologisch gesehen, kann Liebe also blind machen, mehr oder weniger stark. So wie jeder anders liebt, macht die Liebe auch jeden ANDERS BLIND.
von Emeli Röttgers
Dieser Artikel ist ein Teil einer Reihe. Ein weiterer Beitrag ist: Nichts mehr auszusetzen?
Sarah Ellwardt studiert Humanmedizin und schreibt seit März 2020 für den ruprecht – vor allem für das Ressort Wissenschaft. Ihr Antrieb ist es, einen Zugang zu aktuellen wissenschaftlichen Themen zu schaffen, um die Welt verständlicher zu machen. Seit Dezember 2020 leitet sie das Ressort Studentisches Leben.
Aaron Löffler studiert Politikwissenschaft und Philosophie. Für den ruprecht schreibt er seit dem SoSe 2020. Dabei liegt sein thematischer Schwerpunkt vor allem auf dem politischen und philosophischen Zeitgeschehen - in Heidelberg und der Welt außenrum.
Emeli Röttgers studiert VWL im vierten Semester und ist seit dem Wintersemester 2020 beim Ruprecht. Sie stellt sich in ihren Artikeln gerne alltägliche Fragen und versucht diesen auf den Grund zu gehen.