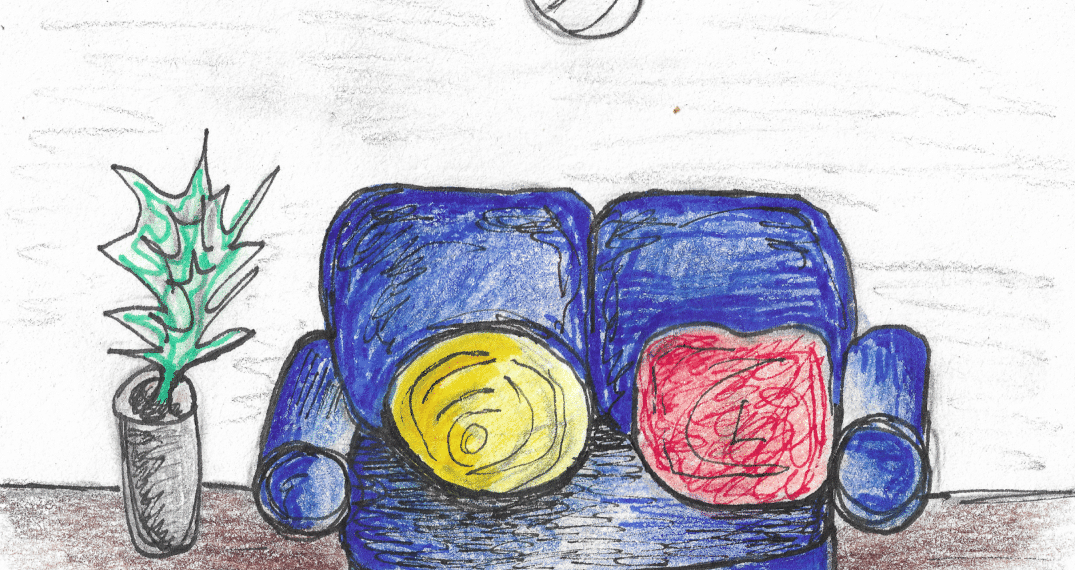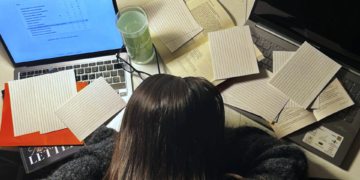Prüfungsangst, fehlende Motivation oder Panik sind Probleme, die vielen Studierenden bekannt vorkommen. Einige suchen Hilfe bei Psycholog:innen. Doch könnten von einer Psychotherapie auch Menschen ohne diagnostizierte Erkrankung profitieren? Darüber sprechen wir mit dem Psychologen Volker Kreß.
Die Krankheitsrate von Menschen, die psychische Störungen haben, hat sich nicht verändert. Gleichzeitig steigt die Anzahl der Menschen, die sich bei Therapeut:innen Hilfe suchen. Volker Kreß arbeitet seit zehn Jahren in der psychosozialen Beratung der Universität Heidelberg. Die Gründe, warum Studierende zur Beratungsstelle gehen, seien vielseitig: Prüfungsangst, fehlende Motivation zum Aufstehen, Arbeitsstörungen, Panik oder wiederkehrende Essstörungen, die als geheilt galten. Studierende aus dem Ausland beispielsweise kontaktieren die Beratung wegen unerwartetem Heimweh und fehlenden sozialen Kontakten. Kreß berichtet, dass viele Studierende zu hohe Ansprüche an sich selbst haben und sich mit anderen vergleichen.
Sollte jede:r zur Psychotherapie gehen?
So kommt die Frage auf, ob eine Psychotherapie auch Menschen helfen könnte, die keine diagnostizierte Erkrankung haben. Laut Kreß bestehe das Problem darin, dass Krankenkassen die Kosten einer Therapie nur übernehmen, wenn eine Diagnose gestellt wurde. Andernfalls würde die Person als „nicht behandlungswürdig“ eingestuft. Aber hat nicht jeder Mensch gestörte Verhaltensmuster, die einer therapeutischen Behandlung würdig wären? Das Setting einer Therapiesitzung, also ein aufmerksamer Gesprächspartner, der fünfzig Minuten zuhört und das eigene Verhalten spiegelt, analysiert oder anspricht, ist entscheidend für den Therapieerfolg. Diese Verfahren seien „nur“ natürliche Prozesse, wie sie auch im Alltag stattfinden sollten, meint Kreß. Also ja, in diesem Sinne sollte jede Person, die das Bedürfnis oder Interesse hat, eine Therapie beantragen.
Neutrales Gegenüber
Das Wichtigste an einer Therapie sei das Gegenüber. Deswegen könne man sich als ausgebildete:r Therapeut:in auch nicht selbst therapieren, so Kreß. Die (körperliche) Präsenz einer zuhörenden Person an einem sicheren und neutralen Ort schaffe Raum für Gespräche über bisher unausgesprochene Themen. Darin liege der Unterschied zu einem Gespräch mit Familie oder Freund:innen: Die Beziehung zu Therapeut:innen hat keine Vergangenheit und keine Zukunft, sodass Patient:innen aussprechen können, was sie wollen, ohne Konsequenzen für ihre zwischenmenschlichen Beziehungen zu fürchten.
„Nehme ich jemandem einen Platz weg, der ihn dringender braucht?“
Einige Patient:innen stellen sich die Frage, ob sie als nicht diagnostizierte Menschen denjenigen Therapieplätze wegnehmen, die sie dringender bräuchten. Aber wer entscheidet darüber, wer krank ist? „Ich denke eher, dass jeder Einzelne individuell die Entscheidung treffen sollte und nicht jemand an einer Schwelle sitzt und sagt, wer darf und wer nicht“, so Kreß. Personen, die gerne eine Therapie machen wollen, sollten dies tun.
Wäre die Welt ein besserer Ort, wenn alle zur Therapie gingen?
Dass alle Menschen zur Therapie gehen, sei mangels praktischer Möglichkeiten ein utopisches Szenario. Die Therapie verwende natürliche und menschliche Mechanismen, nämlich dem anderen in die Augen zu schauen, aufmerksam zuzuhören und zu spiegeln, was man verstanden hat und was nicht. Das Fehlen bedeutsamer Beziehungen sei das Problem. „Würden wir das häufiger tun, wären viele Menschen entspannter und würden sich wohler fühlen“, meint Kreß.
Helena studiert Ethnologie und Soziologie seit dem Wintersemester 2020/21 und ist seit März 2021 bei ruprecht dabei.
Julia Bierlein studiert Jura. Sie schreibt seit Anfang 2021 für den ruprecht, am liebsten über die Uni und das studentische Leben in Heidelberg.