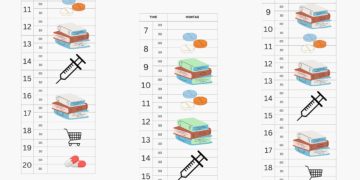Gespannt sitzen 13 Studierende im Seminarraum einer US-amerikanischen Universität. Es ist die erste Stunde des Semesters, die Dozenten sprechen über Organisatorisches. Einer von ihnen ermutigt dazu, mit Texten und Vorträgen genauso wohlwollend wie kritisch umzugehen. Um eine offene Atmosphäre zu schaffen, bittet er darum, die Urheber:innen kritischer Diskussionsbeiträge außerhalb des Seminars nicht zu leichtfertig beim Namen zu nennen. Schließlich sollen wir unsere Ideen frei ausprobieren können, sagt er später in einer Sprechstunde. Ermunterung zu kritischem Denken, Nachsicht, Toleranz: Sieht so die vielbeschworene Bedrohung der Wissenschaftsfreiheit an amerikanischen Universitäten aus?
An der Yale University, einem Mitglied der liberal-elitären „Ivy League“ an der amerikanischen Ostküste, dreht sich die Debatte um die hauseigene Law School. Diese gilt als die beste juristische Ausbildungsstätte der Welt: Vier der neun Richter am Supreme Court, dem Obersten Gerichtshof der USA, haben hier studiert. Auch Hillary und Bill Clinton haben sich hier kennengelernt.
Seit einigen Jahren macht die Law School allerdings immer wieder Schlagzeilen. Zuletzt erregte der Bundesrichter James Ho im vergangenen September Aufsehen, als er ankündigte, Yale-Studierenden fortan keine der begehrten Assistenzstellen (clerkships) mehr zu gewähren. Mehr als ein Dutzend Kolleg:innen folgten seinem Beispiel.
„I don’t want to cancel Yale“, wird Ho zitiert, „I want Yale to stop cancelling people like me.“ Ho kämpft mit Mitteln, die er bei anderen kritisiert. Seine Entscheidung trifft ironischerweise vor allem die konservative studentische Minderheit. Doch ungeachtet dieser Widersprüchlichkeiten: Was ist dran am Vorwurf der „Cancel Culture“?
David* studiert an der Law School. Er findet, auf Seiten der Professor:innen könne man nicht von „liberaler Indoktrination“ sprechen. Vielmehr seien es die Studierenden, die oft nicht dazu bereit seien, ihre liberal-progressive Haltung infrage zu stellen. Auch Julio* belegt hier Kurse. Er gesteht zwar ein, dass konservative Katholik:innen oder autoritäre Rechte unter den Dozierenden seltener seien als an vergleichbaren Law Schools, dennoch nehme er die Institution als „intellektuell diversen Ort“ wahr. In einem seiner Kurse etwa frage der Professor einen Studenten, den Julio als „Faschisten“ bezeichnet, regelmäßig interessiert nach seiner Meinung. „Not everyone just agrees with liberals at Yale Law“, pflichtet ein linker Professor auf Twitter bei.
Aber ist an Hos Vorwurf nicht doch etwas dran? In seiner Attacke bezieht er sich auf einen Vorfall im März 2022. Mit Kristen Waggoner hatte die Federalist Society, eine konservativ-libertäre Jurist:innenvereinigung, die Vertreterin einer LGBTQ-feindlichen christlich-konservativen Interessengruppe eingeladen. Über hundert Yale-Studierende verzögerten die Veranstaltung daraufhin mit ihren Zwischenrufen. Die einen warfen den Protestierenden anschließend vor, die Gastrednerin „gecancelt“ zu haben – die anderen verteidigten den Protest dagegen als Ausdruck von Meinungsfreiheit und kritisierten die bewaffnete Polizeipräsenz.
Wo endet demokratischer Protest und wo beginnt „Cancel Culture“? Für die Law School war es nicht der erste Grenzfall. Bereits 2020 hatte Yale den Rechtsprofessor Jed Rubenfeld für zwei Jahre suspendiert, der Vorwurf damals: sexuelle Belästigung. Als Rubenfeld im Herbst 2022 unter Auflagen auf den Campus zurückkehrt, regt sich Widerstand. Die studentische Frauenorganisation der Law School verteilt pinke Pamphlete, die Studierende über die Ermittlungen gegen Rubenfeld informieren und ihnen nahelegen, seine Kurse zu meiden. Bereits zuvor hatte die Organisation Rubenfelds Entlassung gefordert. Sind die Handzettel eine angemessene Maßnahme, um gutgläubige Kommiliton:innen vor sexueller Belästigung zu schützen? Oder wurde Rubenfeld, der die Vorwürfe abstreitet, „gecancelt“ – zuerst von der Uni-Leitung, dann von seinen Studentinnen?
Der E-Mail-Verteiler der Law School gibt einen Einblick in die freimütige Beschwerde- und Protestkultur. Hier lese ich etwa den Aufruf einer Studentin, in Zukunft nicht mehr nach Hawaii zu fliegen, da dies unter anderem den kulturellen Genozid an der indigenen Bevölkerung fördere. Eine weitere halböffentliche E-Mail-Diskussion dreht sich um die Corona-Maßnahmen. Als die Vertretung der Jura-Studierenden mit Behinderungen dazu auffordert, zum Schutz vulnerabler Gruppen weiterhin Masken zu tragen, beschwert sich eine Studentin: Der Vorstoß diskriminiere Studierende, die aufgrund ihrer Behinderung besonders unter den Masken litten, beispielsweise Schwerhörige.
Bei aller „wokeness“, die in diesen Disputen durchscheint, hat Yale jedoch immer auch Konservative beherbergt. Im hochschuleigenen Debattierklub etwa tummeln sich gleich vier konservative Parteien.
William F. Buckley, Jr., der seiner Alma Mater 1951 in einem Buch Ideologisierung, Religionsfeindlichkeit und Werteverlust anlastete, steht stellvertretend für die lange Vorgeschichte der gegenwärtigen Vorwürfe. Seit 2010 ist in Yale ein Programm nach ihm benannt, das regelmäßig konservative und rechte Redner:innen einlädt, nach eigener Darstellung um die „Redefreiheit“ und „intellektuelle Diversität“ zu fördern. Der jüngste Gast: James Ho.
Auch am History Department spüre ich die Auswirkungen identitätspolitischer Debatten. Kurz vor Semesterbeginn hatte James H. Sweet, der Präsident des größten Historiker:innenverbands der USA, eine emotionale Kontroverse ausgelöst. Dabei ging es um den „Präsentismus“, also in etwa: die Orientierung an Einstellungen und Maßstäben der Gegenwart bei der Interpretation der Vergangenheit.
Geschichte, so Sweet, entwickele sich immer mehr zum Instrument aktueller Identitätspolitik. Als Beispiel führte er das 1619 Project an – ein journalistisches Unterfangen, welches die New York Times 2019 initiiert hatte, 400 Jahre nach der Ankunft der ersten Sklaven in der englischen Kolonie Virginia. Keine Erwähnung fand, dass viele der 1619 aus Westafrika verschifften Sklaven damals nicht nach Nordamerika, sondern nach Mexiko, Jamaika und Bermuda verschleppt wurden. Unterschlägt das Projekt etwa bei dem Versuch, für die Afro-Amerikaner:innen der Gegenwart eine politisch nutzbare Vergangenheit zu beanspruchen, wichtige historische Fakten?
Für die einen ist Präsentismus gleichbedeutend mit mangelhafter Wissenschaft und geschichtsvergessener Ideologisierung. Für die anderen ist er dagegen eine methodische Unumgänglichkeit oder sogar ein ethisches Gebot. Einer meiner Geschichtsprofessoren beschwert sich im Seminar etwa über Sweets „schrecklichen Artikel“. Ein anderer meint dagegen, darin seien „Dinge, die ich verteidigen wollen würde“. Sweet selbst scheint seinen Vorstoß inzwischen zu bereuen; im Nachhinein stellte er seinem Beitrag online eine lange Entschuldigung voran.
Auf einer Geschichtskonferenz einige Wochen später diskutieren Historiker:innen, wie die amerikanische Nationalgeschichte in Zukunft erzählt werden soll. Das Podium ist mit identitätspolitischem Bedacht zusammengesetzt: Ein weißer Historiker trifft auf Kolleg:innen mit indigenen, schwarzen, asiatischen und lateinamerikanischen Wurzeln.
Die respektvolle Diskussion bestätigt meinen Gesamteindruck: Identitätspolitische Fragen führen hier an der Universität zwar zu manch vorschnellem Schluss, aber doch eher zum Dialog als zum „Canceln“.
Vielmehr bleibt mir ein anderes Vorkommnis im Gedächtnis: Der Geschichtsprofessor Paul Ortiz, der in Florida lehrt, erinnert in seinem Beitrag daran, dass das 1619 Project, welche Mängel es auch haben mag, in seinem Bundesstaat offiziell aus den Klassenzimmern verbannt wurde. Wesentlichen Anteil daran hatte Floridas republikanischer Gouverneur Ron DeSantis, der 2024 womöglich für das Präsidentschaftsamt kandidieren wird und die verhasste „Critical Race Theory“ gleich mitverbot.
Vielleicht lässt sich diese Beobachtung verallgemeinern: Die Existenz einer gefährlichen identitätspolitischen „Cancel Culture“, die die Wissenschaftsfreiheit an amerikanischen Universitäten bedroht, ist zumindest fraglich. Die Existenz rechtsautoritärer Zensurbestrebungen sicherlich nicht. (llb)
(*) Namen von der Redaktion geändert
...studiert Geschichte im Master und schreibt seit 2022 für den ruprecht. Er interessiert sich für Vergangenes und Gegenwärtiges im Kino, in der Literatur, in Heidelberg und in den USA.