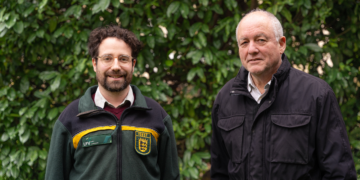Genau ein Jahr ist es her, als der Krieg in Europa ausbrach. Zwei Heidelberger:innen mit ukrainischen Wurzeln berichten, wie sie die ersten Wochen erlebt haben.
Schon lange gab es eine Front im Donbass, schon lange befanden sich russische Soldatenstiefel auf ukrainischem Boden. Doch jetzt kommen sie von allen Seiten. Russische Panzer rollen von Belarus aus über den Grenzfluss Dnipro, Hubschrauber kreisen über Kyiv. Erste Explosionen.
Es ist früh morgens, als auf Lenas Handy in Deutschland die ersten Nachrichten ankommen. Sie ist vor sechzehn Jahren aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Ihre Eltern und ihr Bruder leben noch dort. „Ich habe zu lesen begonnen und meine Hände haben gezittert, mein Handy hat gezittert. Trotzdem musste ich zur Arbeit und ganz normal funktionieren. Bei den ersten Meetings ist mir dann klar geworden: Die Kollegen wissen noch nicht, was passiert ist.“
Schon Wochen vorher waren die Militärmanöver an der ukrainischen Grenze in den internationalen Medien. „Alle haben gewartet: Wird es kommen? Wird es nicht kommen? Bekannte fragten mich: Lena, was passiert in der Ukraine? Was denkst du?“ Lena erzählt, dass sie selbst nicht wusste, wie sie das Geschehen einordnen soll. Die Geheimdienstinformationen und Militäranalysen hätten immer stärker auf eine Invasion hingedeutet. „Gleichzeitig ergab das alles keinen Sinn. Es ist nicht im Interesse Russlands, so etwas anzufangen.“ Ihre einzige Vermutung: „Es muss dem russischen Regime unterträglich sein, ein demokratisches Land neben sich zu haben.“ Ein Sieg Putins, so fürchtet sie damals, wäre das Ende des eigenständigen Staates Ukraine. „Dann wäre die Ukraine wie ein Kurdistan: Sie wäre kein Land mehr, aber sie würde weiterexistieren in unseren Herzen und durch unsere Narrative.“
Auch Robin ist schockiert, als er am 24. Februar die Nachrichten liest. Er ist in Deutschland aufgewachsen, seine Familie ist teils ukrainisch, teils russisch. Einige Verwandte leben auf der Krim, seine Tante in Kyiv. „Ich habe sofort meine Mutter und meine Oma angerufen und war ewig lang am Handy.“ Die Lage ist unübersichtlich: Niemand weiß, wo Bomben gefallen sind oder wo sich Truppen bewegen. Lena erzählt, dass ihr Bruder seine vier Kinder aus Kyiv zu seinen Eltern gebracht habe, wo es sicherer sei. Dann sei er aber selbst wieder nach Kyiv zurückgefahren, um anderen zu helfen. „Das war für mich die schlimmste Zeit: jeden Abend habe ich ihm eine SMS geschrieben: ‚Ich liebe dich.‘. Jeden Tag haben wir uns voneinander verabschiedet.“ Diese Zeit habe sie seltsam gedämpft erlebt, erzählt Lena. „Ich habe nichts gegessen, nicht geschlafen. Der Körper hat einfach so reagiert, damit ich mit dieser stressigen Situation umgehen kann.“
Robin telefoniert in den ersten Tagen ständig mit seiner Familie. Außer seiner Tante wohnt niemand in den umkämpften Gebieten. Ihr gelingt schließlich die Flucht aus dem bombardierten Kyiv. Sie kommt bei Robins Großmutter in Deutschland unter. Doch die schaut regelmäßig russisches Fernsehen. „Sie hat ständig davon geredet, dass dort Nazis wären und dass die Ukraine eigentlich russisches Territorium sei. „‚Deine Tante versteht das nicht‘, hat sie gesagt“, erzählt Robin. In seiner Familie hätten sich zwei Lager gebildet: proukrainisch und prorussisch. Als Robin seine Familie besucht, merkt er schnell, dass Diskutieren zwecklos ist: „Die sind so in dieser Ideologie drin, da kann man mit vernünftigen Argumenten wenig erreichen.“
Mit dem Krieg entbrennt in Deutschland die Debatte um Waffenlieferungen. Noch am Abend des 24. Februar hört Lena im Radio bei einer Talkshow mit einer Friedensforscherin zu. „Die war eine Russlandversteherin. Als ich da zugehört habe, habe ich gemerkt, dass ich keine psychischen Kapazitäten habe, um mit dieser Perspektive in Berührung zu kommen.“ Lena beschließt daraufhin, auf Nachrichtenkanäle zu verzichten, die sich mit der Debatte um Waffenlieferungen befassen. Dennoch muss sie immer wieder die deutschen Entscheidungen vor ukrainischen Bekannten rechtfertigen. „Ich verstehe die deutsche Geschichte und Mentalität sehr gut und es ist schon ein extremer Schritt, von der ‚Nie wieder‘-Haltung auf eine ‚Waffen sind gut‘-Haltung zu kommen. Gerade bei Panzern kann ich auch verstehen, wenn man gehemmt ist. Aber wenn es um Luftabwehrsysteme geht, denke ich: Diese Dinge schützen meine Eltern.“
Auch Robin schränkt seinen Nachrichtenkonsum ein: „Ich will das nicht so an mich ranlassen. Alle paar Tage schaue ich mir die Nachrichten an, aber ich möchte mich da nicht so sehr reinsteigern.“ Als er im Juli für ukrainische Flüchtlinge dolmetscht, erlebt er den Krieg plötzlich sehr viel näher. „Eine Erinnerung prägt mich bis heute: Ein kleiner Junge, vielleicht elf, zwölf Jahre, erzählte mir, dass er mit seiner Mutter in Kyiv gelebt hat. Sie hatte dort einen kleinen Friseursalon. Eines Tages sagte man ihm, dass der Friseursalon bombardiert wurde, als seine Mutter gerade arbeitete. Seitdem ist er Waise. Das hat mich so wütend und traurig gemacht, ich konnte das gar nicht fassen.“
Ein Jahr später hat der Krieg in der Ukraine für viele in Deutschland an Schrecken verloren, er ist Alltagsrealität. Vieles hat sich geändert: Auf gelieferte Helme folgten Panzer und Munition. Vielen Pazifist:innen ist klar geworden, dass Waffenfreiheit nicht immer die Lösung ist. Vielen wurde bewusst, dass auch sie womöglich im Kampf um eine demokratische Gesellschaft zur Waffe greifen würden.
Die Weltsichten haben sich gewandelt, sagt auch Lena. „Früher sahen viele die geopolitische Rolle der USA sehr kritisch. Jetzt hat mir der Krieg gezeigt, dass die Realität nicht so schwarz-weiß ist. So manche antiamerikanische Narrative sind womöglich genauso Propaganda wie die antiukrainischen Narrative.“ Andere unbewusste Vorurteile würden in den Köpfen der Deutschen aber noch festhängen. „Die alte Sowjetunion und Russland werden wie Synonyme benutzt. Dabei ist das alles viel komplexer. Man muss anfangen, die Ukraine und Russland zu unterscheiden.“
von Lena Hilf
...studiert Physik und schreibt seit Oktober 2019 für den ruprecht. Besonders gerne widmet sie sich Glossen, die oft das alltägliche Leben sowie wissenschaftlichen oder politischen Themen. Sie leitete erst das Ressort Hochschule und später das Ressort Wissenschaft.
...studiert Physik im Master und fotografiert seit Herbst 2019 für den ruprecht. Von Ausgabe 200 bis Ausgabe 208 leitete er das Online-Ressort, von Ausgabe 205 bis 210 die Bildredaktion.