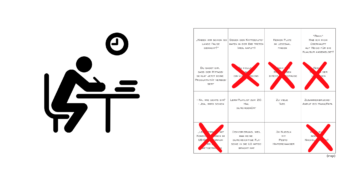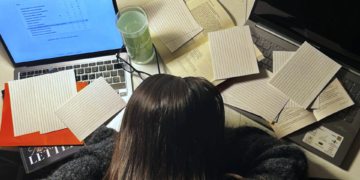Ob Studienalltag oder Klausurenphase: Leistungsdruck und unerfüllbare Selbsterwartungen sind für viele Studierende der Normalzustand. Eine genauere Auseinandersetzung mit unserer Vorstellung von Produktivität zeigt, warum das nicht so sein muss
„Heute werde ich produktiv sein.“ Ein Vorsatz, den sich bestimmt jede:r Student:in schon einmal gemacht hat. Auf die Frage, wie man das am besten umsetzt, gibt es viele Antworten – Self-Help-Autorinnen, Zeitmanagement-Gurus und Produktivitätsinfluencer bieten allerhand Tipps, wie man seine Zeit im privaten und professionellen Leben am besten einteilt. Das Ziel: so gut wie möglich zu funktionieren. Wie das gehen soll, bekommt man in hoch-ästhetisierten Frühaufsteher:innen-Vlogs vorgeführt oder auf den serifenlos bedruckten Seiten minimalistisch gestalteter Bestseller ausführ- lich erklärt – an Inspiration mangelt es also nicht. Wer allerdings versucht, sich in diesem Ratschlägedschungel zurechtzufinden, merkt schnell, dass es die eine perfekte Produktivitätsstrategie gar nicht gibt. Vor allem aber stellt dieses Überangebot an teilweise höchst unrealistischen Effizienz-Lifehacks eine eigentlich viel wichtigere Frage in den Schatten: Warum möchten wir überhaupt alle produktiv sein?
Ein kurzer Blick ins Wörterbuch zeigt, dass das Konzept des Produktivseins nichts Neues ist. Das Wort „Produktivität“ kommt etwa Anfang des 19. Jahrhunderts in den deutschen Wortschatz und bezeichnet ursprünglich das Hervorbringen konkreter Ergebnisse und Produkte, bezogen sowohl auf menschliche als auch maschinelle Leistungen. In der modernen und im Alltag gebräuchlichen Bedeutung des Wortes ist insbesondere dieser Leistungsgedanke immer noch prominent. So bedeutet Produktivsein gemeinhin, so effizient wie möglich zu arbeiten, und dabei möglichst viel zu schaffen. Dieser Gedanke bezieht sich dabei hauptsächlich auf Aufgaben, die einen objektiv ersichtlichen Zweck haben, und priorisiert diejenigen, die uns als Pflicht erscheinen. Wer im Uni-Alltag den Satz „Ich hatte heute so einen produktiven Tag!“ hört, kann beispielsweise davon ausgehen, dass sein Gegenüber all seine Veranstaltungen besucht, vor- und nachbereitet oder die Arbeitsblätter für die nächsten Abgaben durchgearbeitet hat. Auch das Erledigen kleiner Pflichten des Alltags, etwa Haushaltsaufgaben wie Putzen oder Einkaufen, trägt dazu bei, dass man sich produktiv fühlt. Die Verwendung des Begriffs zeigt zudem, dass die Assoziationen mit dem Wort „Produktivität“ vor allem positive sind – wer produktiv gewesen ist, der hat etwas geschafft, etwas erledigt, und ist vielleicht sogar stolz auf das Ergebnis oder zumindest erleichtert, es hinter sich zu haben.
Nicht als produktiv gelten für die meisten Menschen soziale Aktivitäten, Hobbys, Selbstfürsorge oder Ruhe. Kurzum – Dinge, die einen Selbstzweck haben oder einen Wert, der hauptsächlich für das Individuum nachvollziehbar ist. Der Blick auf einige spezifische Freizeitaktivitäten wie etwa den Sport zeigt allerdings auch, dass hier differenziert werden muss. Denn gerade das Sporttreiben gilt durchaus als produktive Tätigkeit. Frank Hofmann, leitender Psychologe der psychosozialen Beratungsstelle des Studierendenwerks in Heidelberg, bestätigt diese Feststellung: „Wir sehen zunehmend, dass auch im Freizeitbereich ein gewisser ‚Produktivitätsdruck‘ vorhanden ist, die Studierenden ihre Zeit ‚sinnvoll‘ nutzen wollen und gezielt nach Aktivitäten suchen, die der ‚Selbstoptimierung‘ dienen.“ Dabei, so Hofmann, gehe dann oft der Erholungsfaktor verloren.
Dass sich viele Studierende kaum eine Pause gönnen, hat seine Gründe. Denn wenn es um Produktivität geht, geht es immer auch um Wahrnehmung – sowohl Fremd- als auch Selbstwahrnehmung spielen hier jeweils wichtige Rollen. Eine von der Redaktion geführte Umfrage unter Heidelberger Studierenden zeigt, dass rund 60 Prozent der Studierenden den Druck, sich mit anderen Kommiliton:innen im individuellen Studiengang messen zu müssen, als äußerst hoch empfinden. Weiterhin geht aus der Umfrage hervor, dass ein Großteil der Studierenden über alle Studiengänge hinweg sehr hohe Ansprüche an die eigene Leistung haben. Diese Erwartung an die eigene Leistung kommt zwar vermeintlich von innen, ist jedoch in vielen Fällen eine Internalisierung bestimmter in der Gesellschaft und im eigenen sozialen Milieu vorherrschenden Erwartungen. Auch der Anspruch an das Produktivsein, der in erster Linie ein Selbstanspruch zu sein scheint, wird maßgeblich von den Werten unserer „Leistungsgesellschaft“ beeinflusst, an denen wir unsere Entscheidungen über den besten Gebrauch unserer Zeit orientieren. „Wir lernen früh, dass Leistung geschätzt wird und bekommen Lob für gute Noten. Produktiv zu sein, Aufgaben und Herausforderungen zu bewältigen und sinnvolle Dinge zu tun, ist für viele Menschen ein Wert und auch eine wichtige Quelle von Zufriedenheit und Selbstbewusstsein,“ so Hofmann.
Aber was sind denn „sinnvolle Dinge“? – eine Frage, die wir uns alle vermutlich nicht oft genug stellen. Der sogenannte „Hustle“ hält uns nämlich auch davon ab, in eine Sinnkrise abzurutschen. Indem wir uns dazu verpflichten, alle unsere Aufgaben systematisch abzuarbeiten, wird die Bearbeitung der Aufgabe als solche wichtiger als ihr eigentlicher Inhalt. So kommt es, dass man sich auch bei der Erfüllung inhaltlich sinnloser Aufgaben produktiv fühlen kann. Produktivität hat also tatsächlich oft wenig mit dem Sinngehalt von Aufgaben zu tun, sondern eher mit ihrem Status als „to do“.
Im Studium kann die To-Do Liste unendlich lang werden, was im Studienalltag und insbesondere in den Klausurenphasen zum Problem werden kann. Etwa 70 Prozent der Studierenden, die sich an die psychosoziale Beratungsstelle des Studierendenwerks wenden, haben Schwierigkeiten bei der Bewältigung ihres Arbeitspensums. Eine große Menge an Stoff, offene Fragestellungen, fehlende Deadlines, kompetitive Atmosphären, Probleme bei der Zeiteinteilung – all dies können Ursachen dafür sein, dass Stress und Leistungsdruck steigen und die Motivation erstickt wird. Wenn der Druck steigt und man vor vielen Aufgaben steht, kann man ganz unterschiedlich darauf reagieren. Ein weit verbreitetes Phänomen ist es, diese erst einmal vor sich herzuschieben. Prokrastination, so heißt diese Bewältigungsstrategie, hat dabei aber nichts mit Faulheit zu tun, sondern hängt mit der Angst vor dem Versagen zusammen. Und je größer die Aufgabe, desto größer diese Angst.
Viele Studierende sehen diese Angst dabei als begründet – die Zweifel an den eigenen Fähigkeiten schlagen sich oft im sogenannten „Imposter-Syndrom“ nieder. Dieses Phänomen, zu Deutsch Hochstapler-Syndrom, bezeichnet das Gefühl, sich in einer Umgebung zu befinden, in der man einen Status innehat, den man der eigenen Wahrnehmung nach nicht verdient. Das Gefühl, alle anderen seien besser, schlauer und insgesamt auf einem ganz anderen Niveau, ist symptomatisch für diese Außenseiter:innenwahrnehmung. Dieses Gefühl kann verschiedene Ursachen haben. Grundsätzlich handelt es sich meistens um einen Mangel an Selbstbewusstsein und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Dieses Selbstmisstrauen kann jedoch auch systematische Grundlagen haben, etwa für Frauen in traditionell männlich dominierten Fächern, die bereits rein statistisch gesehen Außenseiterinnen sind.
Produktivitätsansprüche, Prokrastination und „Imposter-Syndrom“ haben allesamt eines gemeinsam: Sie finden auf der Basis sozialer Vergleichsprozesse statt. Besonders am Anfang des Studiums ist der Drang hoch, sich mit anderen Studierenden zu vergleichen, um sich in dieser neuen Umgebung eine Orientierung zu verschaffen. Die Frage „Mache ich alles richtig?“ ist aber notorisch schwer zu beantworten, da, wie jeder verunsicherte Ersti zu seiner weiteren Verunsicherung sicherlich bemerken wird, Studierende ihr Studium sehr unterschiedlich handhaben. Wer vergleicht, der sucht meist nach einer Basis für Wertungen. Im Studium führt das dazu, dass Studierende sich selbst im Ergebnis ihrer Vergleiche herauf- oder herabwerten. Der Mangel an Wissen über die Position der Anderen im Vergleich zu dem sehr differenzierten Bild, das wir von uns selbst haben, kann dazu führen, dass solche Wertungen undifferenziert und oft schlicht falsch sind. „Wir sehen ja in der Bibliothek nur jemanden, der vor einem offenen Buch sitzt, nehmen aber an, dass diese Person strukturiert und konzentriert arbeitet“, stellt Hofmann fest. Und selbst wenn diese Person tatsächlich produktiv wäre – funktioniert Produktivität denn wirklich so, wie wir denken?
Jein. Denn das, was wir gemeinhin unter Produktivität verstehen, hat so seine Tücken. Jede:r, die:der sich dieses noble Ziel schon einmal gesetzt hat, wird gemerkt haben, dass auf jede erledigte Aufgabe eine neue folgt. Hat man die eine Vorlesung nachbereitet, kann man mit der Vorbereitung der nächsten beginnen, jedes Arbeitsblatt hat auch noch eine Rückseite, und am Ende des Tages steht immer noch das dreckige Geschirr im Spülbecken. Überhaupt müsste man die Küche mal putzen. Und das Bad. Und das eigene Zimmer hat auch dringend einen Durchgang mit dem Staubsauger nötig. Das ist das grundlegende Paradox der Produktivität: Je mehr man tut, desto mehr gibt es zu tun. Wer sich trotzdem vornimmt, produktiv zu sein, nährt irgendwo in den Untiefen seines Unterbewusstseins den utopischen Glauben, dass eines Tages alle Aufgaben erfüllt sein werden. Das Streben nach Produktivität ist ein Streben nach Perfektion, nach einem unerreichbaren Optimalzustand, der in Wirklichkeit wahrscheinlich nichts weiter ist als eine Fata Morgana in der Wüste der Zukunft.
Trotzdem müssen wir das Produktivsein aber nicht aufgeben. Wir können stattdessen versuchen, diesen Anspruch anders anzugehen. Eine erstrebenswerte Produktivität ist vielleicht eine, die über das bloße Funktionieren hinausgeht und Tätigkeit nicht von ihrem Sinn trennt, sondern im schöpferischen, positiven Sinne produktiv ist. Denn wer etwas tut, nicht nur um es getan zu haben, sondern sich gleichzeitig des Sinns seines Tuns bewusst ist, wird vermutlich weniger unter hohen Selbstansprüchen, Produktivitätsdruck und Stress leiden. Stattdessen bekommt man die Möglichkeit, sein Selbstbewusstsein und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken. Und wer bei jeder Aufgabe das Erledigen priorisiert, den Sinn hinten anstellt und am Ende des Tages zu seiner Enttäuschung feststellt: „Ich war heute schon wieder unproduktiv“, der muss sich früher oder später die existenzielle Frage stellen: Warum tue ich, was ich tue?
Von Michelle Schmid und Odette Lehmann
...studiert Germanistik im Kulturvergleich und Soziologie im Bachelor und leitet seit dem Wintersemester 2024/25 das Ressort "Studentisches Leben". Sie ist seit Ende 2023 beim ruprecht aktiv und interessiert sich besonders für Dinge, die eine gründliche Dosis Reflektion und neue Perspektiven gebrauchen können, deshalb schreibt sie gerne über aktuelle gesellschaftliche, kulturelle und politische Themen.
...studiert derzeit Amerikanistik und schreibt seit November 2023 für den ruprecht, um während ihres Studiums bereits Erfahrungen und Praxiskenntnisse für ihren Traumberuf als Autorin und Journalistin zu sammeln. Ihre besonderen Interessen im Schreiben liegen in den Bereichen Psychologie, Bildungswissenschaften und Popkultur.
...studiert irgendwas mit Naturwissenschaften (Molekulare Biotechnologie) und schreibt seit Sommersemester 2023 für den ruprecht. Neben der Leitung der Bildredaktion ist er vor allem für Illustrationen, Wissenschaft und Satire immer zu haben.