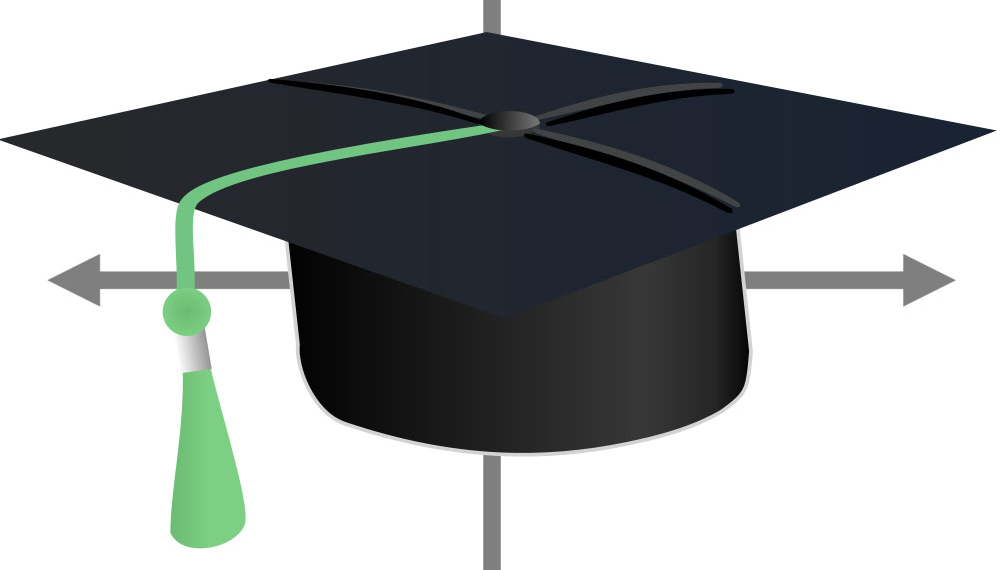Das Studium wird immer spezialisierter. Brauchen wir eine breitere Bildung?
[box type=“shadow“ align=“alignright“ ]
PRO
Das allseits bekannte Sprichwort vom „über den Tellerrand hinausschauen“ gilt auch für das Studium. Egal in welchem Studiengang: Sich selbst und das eigene Fach im Spiegel anderer akademischer Disziplinen zu sehen, schafft Bewusstwerden, neue Ideen und neue Kontexte. Allein schon deshalb ergibt es Sinn, sich im Studium auch in die Breite zu orientieren. Die Wissenschaften selbst funktionieren darüber hinaus oft interdisziplinär: Was würden Biologen ohne Kenntnisse zu ihren Nachbarn Chemie und Mathematik machen? Und, besonders im Bereich der Genetik, ohne Recht und Ethik? Was wiederum täten Grabungswissenschaften ohne eine naturwissenschaftliche Altersbestimmung ihrer Funde? Wo stünden viele Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften ohne philosophische und soziologische Theorien – ohne Michel Foucault, ohne Max Weber? Wo wiederum die Soziologie ohne Erkenntnisse der Psychologie? Dass solche interdisziplinären Ansätze in Zeiten von verschultem ECTS-Punktesammeln nicht mehr unbedingt freiwillig von den Studierenden verfolgt werden, ist verständlich. Die logische Konsequenz: auch Wahlpflichtmodule, die zwingend außerhalb der eigenen Fachgrenzen absolviert werden müssen, gehören in Studienordnungen verankert. Und auch später nützt das erweiterte Allgemeinwissen, denn es verschafft Vorteile in jedem Beruf. Besonders, aber nicht ausschließlich gilt das für die Geisteswissenschaften, denn deren Absolventen dieser Fächer arbeiten oft fachfremd. Natürlich werden Wissenschaft und Arbeitswelt immer komplexer, und Spezialisierung schon im Studium scheint nötig, für die Wissenschaft gar unabdingbar zu sein, aber gerade dann hilft eine Ergänzung durch Allgemeinbildung enorm dabei, nicht zum „Fachidioten“ zu werden. Auch wenn Wilhelm von Humboldt schon lange tot ist, hat sein Bildungsideal ein zeitgemäßes Weiterleben sicherlich verdient.
von Simon Koenigsdorff[/box]
[box type=“shadow“ align=“alignright“ ]
CONTRA
Wer in Heidelberg studiert, kennt mit Sicherheit die übergreifenden Kompetenzen. Zuhauf stehen sie in den Studienordnungen der Universität und ermöglichen, ja verordnen es den Studenten, über den Tellerrand des eigenen Faches zu blicken. Es ist kein Trend aus dem Nichts: Interdisziplinarität heißt das von der Wissenschaft propagierte Zauberwort, das aus dieser heute nicht mehr wegzudenken ist.
Die fächerübergreifende Arbeitsweise birgt jedoch auch Gefahren für den wissenschaftlichen Nachwuchs, denn Breite darf nicht auf Kosten von Tiefe gehen und zu Oberflächlichkeit führen. Für eine wissenschaftliche Karriere sind fachliche Spezialisierungen unabdingbar. Experte wird logischerweise nur, wer sich in seinem Fachgebiet besonders gut auskennt. Je stärker die Uni Wissen in der Tiefe vermittelt, desto besser sind die Chancen, echte Spezialisten herauszubilden. Es ist wenig sinnvoll, sich als Student in der Methodik benachbarter Fachdisziplinen zu verirren, wenn man noch nicht einmal sein eigenes Fach beherrscht. Und welcher Student kann das schon von sich behaupten?
Auch für das Berufsleben fernab der Uni ist Bildung in der Breite nur bedingt von Vorteil, zu spezifisch sind die in den Stellenausschreibungen geforderten Qualifikationen. Kein Arbeitgeber braucht Fachidioten, Fachleute hingegen schon. Wer weiß, in welchem Bereich er später arbeiten möchte, tut gut daran, diese Qualifikationen mitzubringen, anstatt lediglich in alles ein wenig hineingeschnuppert zu haben.
Ein breites Allgemeinwissen ist im (Berufs-)Leben sicherlich von Vorteil. An die Curricula muss es deshalb aber nicht gebunden werden, zumal das ECTS-Punktesammeln auch vor dem fächerübergreifenden Bereich keinen Halt macht und keinesfalls breites Wissen garantiert. Zudem hindert niemand die Studenten daran, sich als Gasthörer in fachfremde Veranstaltungen zu setzen oder in der Freizeit Kant zu lesen.
von Jesper Klein[/box]