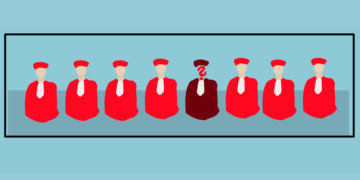Laut Deutschem Studentenwerk werden Studierende finanziell nicht ausreichend gefördert.Schuld ist ein System, das nicht der Lebenswirklichkeit entspricht
Wir müssen uns den Studierenden als einen reichen Menschen vorstellen. Anders kann die Überschrift „Der Durchschnittsstudent hat 918 Euro im Monat“ der FAZ vom 27. Juni nicht verstanden werden. Ihr Anlass ist die im Juni erschienene Studie des Deutschen Studentenwerks (DSW), welche die finanzielle Situation deutscher Studierender im vergangenen Jahr beleuchtet. Anders als die Überschrift vermuten lässt, zieht die Studie jedoch kritische Bilanz: Das studentische Leben ist demnach mit einem hohen finanziellen Druck verbunden, nicht zuletzt durch eine staatliche Unterfinanzierung.
Denn obwohl vier von fünf der Geförderten angeben, dass sie ohne ihren monatlichen BAföG-Satz keine Hochschule besuchen könnten, ist die Erwerbstätigkeit unter Studierenden um 6 Prozent auf 68 Prozent gestiegen; das Taschengeld der Eltern hat sich mit 209 Euro in den letzten vier Jahren um 7 Prozent erhöht. Einkommen folgt aus Eigenerwirtschaftung: „Die Bundesregierung muss den studentischen Bedarf empirisch ermitteln“, fordert Bernhard Börsel, Betreuer des Projekts am DSW. „Der Begriff ‚Durchschnittsstudent‘ ist pauschalisierend und eindimensional gedacht. Studierende waren wahrscheinlich nie eine homogene Gruppe.“
Ich hatte panische Angst, dass mir das Geld gekürzt wird
Es sind Zahlen, die das BAföG als ein Unterstützungssystem entlarven, das zu oft realitätsfern arbeitet: Und so wird der Master-Student nicht gefördert, wenn er bei Antritt seines Studiums älter als 35 Jahre ist. „Die BAföG-Regulierungen sind auf ein ganz bestimmtes Studienbild zugeschnitten“, meint Rainald Malther, Co-Autor der bildungskrischen Anthologie „Was bildet ihr uns ein?“. „Wer es sich nicht leisten kann, zu studieren, geht eher einen Weg, der schneller Geld verspricht als Interessen erfüllt.“
Es ist das Bild eines 18-jährigen Max Mustermanns, der sein Studium in Regelstudienzeit absolviert. Max hat Glück, dass er in einem akademischen Haushalt aufgewachsen ist: Ein Studium, das über die Regelstudienzeit hinausgeht, wird nur in Ausnahmefällen gefördert.
Es ist ein Max, der einen begehrten Platz im Wohnheim ergattern konnte – und das noch dazu in einer Kleinstadt. Denn mit 250 Euro ist auch die Wohnbedarfspauschale fernab von jeder Lebensrealität: Da dieser Betrag bundesweit standardisiert ist, steht dem Münchener Studierenden auf seiner Wohnungssuche damit genauso viel zur Verfügung wie dem Studierenden aus Siegen.
Paradoxerweise kommt es Max auch zu Gute, dass er aus einem finanziell stabilen Haushalt kommt: Verschuldet sollten seine Eltern nämlich nicht sein, der BAföG-Satz rechnet nur mit ihrem positiven Einkommen – Kredite oder Schulden werden vom Amt nicht berücksichtigt. Wenn Studierende aufgrund dieser Notlagen keinen Unterhalt erhalten, können sie zwar eine Vorausleistung vom Amt beantragen, riskieren so jedoch auch, dass ihre Eltern juristisch belangt werden. „Meine Eltern gaben mir so viel, wie es ging“, erklärt eine Mainzer Studentin der ZeitCampus. „Ich hätte es moralisch verwerflich gefunden, sie dafür anzuklagen, dass sie mich nicht noch mehr unterstützt haben.“
Da Max auch ein Mensch ist, der nie zweifelt, zieht er keinen Studienfachwechsel in Betracht: Falls dieser im vierten Semester stattfindet, kann eine weitere Förderung auch nur in Ausnahmefällen bewilligt werden. Er muss also einfach darauf hoffen, dass er bis zu seinem 20. Geburtstag jene Entscheidungen richtig getroffen hat, die den Rest seines Lebens beeinflussen könnten: Also entscheide weise, Max – oder fang zumindest schon mal an zu sparen.
Marie Fischer*, Anglistik-Studentin aus Heidelberg, ist kein Max: In ihrem BAföG-Satz werden Beträge einkalkuliert, die nur theoretisch vorhanden sind; im Monat werden ihr rund 400 Euro gewährt. Durch die günstige Miete im Wohnheim bleiben ihr noch 200 Euro. „Wenn die Semestergebühren fällig sind, sieht es für den Rest des Monats nicht mehr so gut aus“, sagt Fischer. Ein Nebenjob ist unausweichlich, das Einhalten der Regelstudienzeit gestaltet sich dadurch immer schwieriger: „Durch meine Jobs fallen zwei Tage in der Woche weg, an denen ich Kurse belegen könnte.“ Andere Einkommensquellen hat Fischer nicht.
Der Psychosozialen Beratungsstelle zufolge geben 17 Prozent ihrer Patienten an, durch finanzielle Probleme deutlich belastet zu sein. Fischer kann das nachvollziehen: „Nach meinem Fachwechsel hatte ich panische Angst, dass mir das Geld gekürzt wird.“ Fischer ist kein Mustermann und doch bestätigt sie ein Muster: Sie ist ein Regelfall, den die Bundesregierung ignoriert.
Und so steckt sie in einem System fest, das unter dem Deckel der Bildungsoffenheit steht und doch nach Wirtschaftlichkeit beurteilt; ein System, das Studenten nur als Zahlen wahrnimmt und äußere Umstände außer Acht lässt. Janek Heß, Vorstandsmitglied des „freien zusammenschluss von studentInnenschaften“ fordert eine Erhöhung des Satzes um mindestens 6,5 Prozent: Es wäre zumindest ein Schritt in die richtige Richtung, „denn irgendwann zweifelt man daran, ob das Studium den ganzen Stress überhaupt wert ist“, sagt Fischer.
Eine Stellungnahme zu den Ergebnissen der DSW-Studie erachtet das Bundesministerium für Bildung und Forschung auf Anfrage des ruprecht als „nicht zielführend“. Eine offizielle Mitteilung ist noch dieses Jahr geplant. Ein kleiner Tipp, der das Formulieren erleichtern könnte: Sie müssen sich den Studierenden als einen echten Menschen vorstellen.
*Name von der Redaktion geändert
Von Sonali Beher