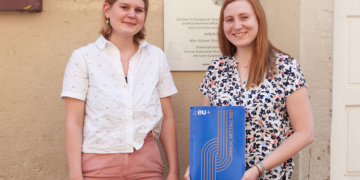Barbès ist das letzte Migrantenviertel im durchgentrifizierten Paris, ein buntes, vielfältiges und nicht zuletzt gefährliches Gewimmel. Bericht eines ereignisreichen Abends
[dropcap]E[/dropcap]s ist kurz vor fünf Uhr morgens und ich liege übernächtigt im Bett eines Pariser Hostels. Durch das einfach verglaste Fenster höre ich den sich hebenden Straßenlärm. Die ersten Pendler machen sich auf, um in der Innenstadt ihre Arbeit anzutreten. Zusammen mit den Rufen der Lieferanten und dem ständigen Motorjaulen formen sie eine Geräuschkulisse, die einen ruhigen Schlaf schnell zur fernen Erinnerung gerinnen lässt.
Und doch bekomme ich den Lärm kaum mit. Ich wälze mich seit Stunden im Bett und versuche den vergangenen Abend zu verarbeiten. Wütend bin ich, ohnmächtig und fassungslos. Und über allem schwebt ein Gedanke: Du bist gerade überfallen worden.
Der Abend beginnt ziemlich genau 12 Stunden zuvor, als mir die Pariser Abendsonne blendend entgegenblitzt.Meine Unterkunft ist in der Nähe des Montmartre. Schon beim Verlassen der Tram-Station sind die atmosphärischen Veränderungen zur Innenstadt spürbar. Der innerste Zirkel der Stadt ist geschniegelt und gestriegelt, die Boutiquen bieten alle möglichen Feinheiten zu den unmöglichsten Preisen und an den vielen Büchereien und Antiquariaten des Universitätsviertels gibt sich die Jutebeutel tragende Bohème die blankgewetzte Klinke in die Hand.
Am Montmartre sind hier die Häuser weniger prächtig und die Preise nicht ganz so exorbitant. Doch die Gegend wirkt ehrlicher als die überzuckert heile Welt im Stadtinneren. Nachdem ich meine Schlüssel abgeholt habe, mache ich mich wieder auf. Eine knappe halbe Stunde muss ich laufen, um bis zum nächsten Kino zu gelangen. Auf meinem Weg passiere ich mehr und mehr Waschsalons und stillgelegten Fabriken, der Duft offensichtlich afrikanischer Gewürzläden zieht in meine Nase. An der Straßenseite spielen drei Straßenmusikanten Variationen auf „Over the rainbow“. Dann biege ich ab.
Überfall
Die Veränderung ist frappierend. Die Straße wird enger und die Häuser an beiden Seiten wirken noch eine Spur desolater. In der Straße liegt Müll, Verpackungspappe schwimmt in den regengefüllten Schlaglöchern, achtlos weggeworfen von den Angestellten des rückwärtig gelegenen Supermarktes. Während zuvor noch eine bunte Mischung jedweden kulturellen und ethnischen Kontextes durch die Straßen tingelte, sind es nunmehr nahezu ausschließlich Menschen mit nordafrikanischen und arabischen Wurzeln. Das rasante Französisch der maghrebinischen Einwanderer ist omnipräsent.
Die Gasse vor mir ist lang und geradlinig, ihr Ende nicht zu sehen. Nur wenige Meter vor meinen Füßen wird die halbe Straße von einer Baustelle blockiert. Ich habe gerade die Straßenseite gewechselt, da taucht von jener bis eben verdeckten Seite der Straße eine Gruppe von einem guten Dutzend noch nicht allzu lang der Pubertät entwachsener Jungmänner auf.
Zunächst scheint es so, als wollten sie mich ohne weiteres passieren. Doch kurz bevor sie an mir vorbei sind, löst sich einer aus ihrer Mitte und baut sich im Zugehen vor mir auf, die anderen hinter sich. Er macht sich noch die Mühe, ein „Hast du ein bisschen Geld für uns?“ in seinen Oberlippenflaum zu nuscheln. Dann geht alles ganz schnell.
Bevor ich etwas erwidern kann, stürzt sich die Gruppe schreiend auf mich. Sie boxen mich in die Seite, zerren an meiner Jacke und meinem Rucksack. Offensichtlich wollen sie meine Unbefangenheit nutzen und sich schnell meiner Wertsachen bemächtigen.
Ich bin wie eingefroren. Meine Handlungen laufen reflexartig, mein Denken hat sich zu einem einzigen Gedanken verdichtet: Raus hier, aber schnell. Ich krümme mich zusammen, vergrabe meine Hände tief in den Taschen. Die Menschen um uns herum indessen beobachten das Geschehen ruhig. Die Aktion dauert nur wenige Sekunden. Nach wenigen vergeblichen Rüttlern und Püffen laufen sie weg, johlend und berauscht von ihrer Männlichkeit.
Als das Geschrei der Jugendlichen langsam in den Gassen verklingt, bleibe ich alleine am Bauzaun zurück. Mein Herz rast und durch die verbogene Brille sehe ich nur noch verschwommen. Egal. Ich gehe los, laufe immer schneller und schneller. Nur raus aus dieser Straße. Ich schaue den Menschen in meiner Nähe nicht mehr in die Augen. Der Blick richtet sich starr auf das Pflaster vor meinen Füßen. Dennoch sehe ich aus den Augenwinkeln die Passanten um mich herum. In ihren dunkelhäutigen Gesichtern sieht mein Gehirn keine Menschen mehr. Es sieht Gefahr.
Tarek
Wenig später verlasse ich die Seitengasse. Allein der Anblick europäisch aussehender Menschen gibt mir in diesem Moment Sicherheit. Vor dunkelhäutigen Passanten zucke ich zurück. Ihr Anblick verursacht in mir ohnmächtige Wut, ja Abscheu. Der Schock beherrscht immer noch meine Gedanken. Die nächsten zwei Stunden sitze ich im Kino, bewegungslos. Ich muss an ein Gespräch mit meinen Eltern denken. Ich solle auf mich aufpassen, rieten sie mir noch vor wenigen Tagen. Paris sei nicht immer harmlos. Ich habe ihre Bedenken weggewischt. Würde schon nichts passieren. Überfälle, Beschaffungskriminalität, soziale Brennpunkte, all das war an meinen bisherigen Wohnorten – Speckgürtel Frankfurt, Heidelberg, Dijon – zumindest gefühlt ewig weit weg. Der Fall aus der Blase lässt mich in diesem Moment hilflos zurück.
Als ich das Kino wieder verlasse, kommt nach wenigen Metern eine verwirrte, hagere Frau auf mich zu. Ihre zerrissene Kleidung und das von Drogen gezeichnete Gesicht sprechen Bände. Sie keift mich an. Und auch wenn sie bald wieder ablässt – das schreiende Gefühl in mir ist zurück. Ein junger Mann, Tarek, nähert sich. Er fragt, ob er mir helfen könne. Auch wenn ich im ersten Moment zurückzucke – dankbar bitte ich ihn, mir den Weg zur nächsten Tram-Haltestelle zu zeigen. Auf dem Weg kommen wir ins Gespräch. „Die Frau eben wollte dein Handy klauen“, vermutet er. Drogen seien schließlich teuer. Und die meisten, die hier Nacht für Nacht liegen, seien schon lange nicht mehr Herr ihrer selbst. Tarek selbst, so erzählt er, lebt seit einem Jahr auf der Straße. Eine bittere Trennung ließ ihn in eine tiefe Depression fallen. Zuerst setzte ihn sein Arbeitgeber vor die Tür, kurze Zeit später auch sein Vermieter. Jetzt lebt er von Gelegenheitsjobs. Und muss jede Nacht hoffen, dass ihn jemand unter seinem Vordach schlafen lässt. Ich berichte Tarek von dem Überfall. Von den Leuten um uns herum, die dabeistanden und es einfach geschehen ließen. Von der Panik, die meine eigene Wahrnehmung in ein rassistisches Schwarz-Weiß-Bild gleiten ließ. Es sprudelt nur so aus mir heraus.
Tarek hört geduldig zu, nur gelegentlich fragt er mit leiser Stimme nach. Auch wenn ich ihn erst seit wenigen Minuten kenne – als wir uns wenig später verabschieden, fällt es mir schwer, meine Dankbarkeit auszudrücken. „Niemand“, sagt Tarek noch beim Händedrücken, „ist von sich aus schlecht. Aber schlecht gemacht werden in diesen Umständen viele.“
Ein Blick zurück
Die Umstände, von denen Tarek spricht, haben in Barbès eine traurige Tradition. Im 19. Jahrhundert befand sich hier ein Arbeiterviertel. Rund um den „Boulevard Barbès“ wohnte nur, wer sich nirgendwo anders eine Bleibe leisten konnte. Ein Leben, oftmals in Elend und Aussichtslosigkeit, das durch Émile Zolas furios zugespitzte Anklageschrift „Der Totschläger“ auch literarisch zum Paradebeispiel sozialer Ungerechtigkeit avancierte.
Kurz nach dem zweiten Weltkrieg siedelten sich in Barbès hier viele Einwanderer aus Nordafrika an. Für die außerhalb ihres „Klein-Afrika“ diskriminierten und benachteiligten Einwandererfamilien wurde das Viertel ein Stück Heimat. Eine Tendenz, die sich gehalten hat. Auch heute noch stellen Einwanderer im Stadtbezirk von Barbès, der Goutte d’Or, ein gutes Drittel der Bevölkerung. Doch die Probleme der Arbeiterzeiten blieben auch nach der Ankunft der neuen Bewohner bestehen: Die Kriminalitätsrate war und ist hoch, Zwangsprostitution und Drogenhandel florieren.
Alles beim Alten, könnte man also sagen. Und doch beginnt sich Barbès zu ändern. Die „Gentrifizierung“ geht um. Häuser werden restauriert, instandgesetzt und zu astronomischen Preisen vermietet. Gleichzeitig ist zumindest auf den großen Boulevards die Sicherheit einigermaßen gewährleistet, seitdem die Gegend 2012 zur besonders geschützten „zone de sécurité prioritaire“ erklärt wurde. Die Einwanderer werden so nach und nach verdrängt, in die Seitengassen und Hinterhöfe von Barbès. Die Probleme, verursacht von Armut, Ignoranz und Diskriminierung, verschwinden dadurch freilich nicht.
Abschied
Zwei Tage später steht der Rückweg nach Dijon bevor. Auf dem Weg zum Pariser Bahnhof steige ich noch einmal an der Tramstation in der Nähe des Kinos aus. Es ist früher Abend. Lediglich einige Passanten hasten, vom Nieselregen getrieben, an mir vorbei. Das Kino liegt an einem Nebenkanal der Seine. Auf der gegenüberliegenden Seite des Wassers feiern junge Leute, vermutlich Studenten, ausgelassen.Ein junger Mann erhebt sich. Man hört ihn laut rufen, das Wasser trägt den Schall: „Champagner! Holt mehr Champagner!“
Gegenüber, an der Seitenwand des Kinos, hat sich eine kleine Familie unter dem Schutz des Vordaches und einiger notdürftiger Decken zusammengekuschelt. Sie sehen mitgenommen aus. In ihrer Mitte sitzt ein kleines Mädchen, sie trägt einen hellblauen Fleece-Pulli. Ihre viel zu kleine Hose reicht nur bis zum Knie. Gefesselt blickt sie ins Gesicht ihrer Mutter, die ihr eine Geschichte zu erzählen scheint. Den Lärm, der ihnen entgegenschallt, scheinen sie gar nicht wahrzunehmen. Plötzlich schreit das kleine Mädchen laut auf. Die Geschichte hat eine dramatische Wendung genommen, sie blickt ihrer Mutter entsetzt in die Augen. Der junge Mann, der eben noch lautstark mehr Champagner bestellte, schaut verwundert auf. Er bemerkt sie, senkt betroffen den Blick. Und blickt nicht mehr zurück.
Von Jakob Bauer