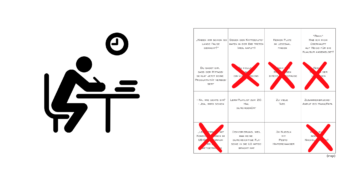Tagelang unproduktiv sein macht vielleicht in den Ferien Spaß. Aber im arbeitswütigen Alltagstrubel? Schwierig, findet unsere Autorin
[dropcap]D[/dropcap]as süße Nichtstun, il dolce far niente. Ein verheißungsvoller Gedanke, den die Italiener da predigen: Sich einfach zurück lehnen und die Beine baumeln lassen. Nicht, weil man es sich verdient hätte, sondern einfach so, weil es gut tut.
Das einzige, was meine Beine bisher tun, ist nervös zu kribbeln. Ich liege am Stafforter See, irgendwo zwischen Heidelberg und Karlsruhe. Im Wasser planschen lachend meine Freundinnen, die tief stehende Sonne spiegelt sich auf der Oberfläche. Ansonsten nichts, nur die summende Stille eines heißen Sommertages. Eigentlich wunderschön, sage ich mir, genieß das doch! Aber es gelingt nicht. Unruhig und getrieben hocke ich auf der Picknickdecke und diffuse Gedanken hetzen mir durch den Kopf. Am liebsten würde ich aufspringen und losrennen. Nur, um mich irgendwie vom Fleck zu bewegen, um nicht länger untätig zu bleiben.
Eine Woche lang Nichtstun? Mir reichen schon vier Tage, um zu bemerken, dass il dolce far niente gar nicht so dolce ist wie gedacht. Langweilig hatte ich mir das vielleicht vorgestellt, aber nicht stressig. Am Ende des Tages nichts Greifbares geschafft zu haben, fühlt sich ungewohnt an. Ungewohnt und falsch.
Früher noch ein Privileg des Adels, ist das Nichtstun heute gesellschaftlich verpönt. Schon vor 50 Jahren beobachtete der Schriftsteller Siegfried Lenz eine regelrechte Arbeitswut. Je härter und heftiger man schufte, desto größer sei die Genugtuung, schrieb er damals. Und heute? Heute ist Überarbeitung kollektiver Standard. Allein beim Gedanken an Freizeit kräuseln sich vermutlich in so mancher Chef-etage die Nackenhaare. Fleiß, Ehrgeiz und Betriebsamkeit sind sexier denn je. An der Uni ist das nicht anders: Es gibt immer etwas zu lesen, zu lernen, zu leisten. Wen die Arbeitslast nicht erschlägt, der macht etwas falsch.
So wie ich. Für mich ist unser Ausflug an den See bloß ein weiterer Tag in meiner Dauerschleife der Muße. Für meine Freundinnen hingegen ist er ein wohlverdienter Ausgleich zum Unistress. Kein Wunder, dass sie ausgelassen durchs Wasser tollen, während ich mit meinem schlechten Gewissen hadere.
Denn das ist auch so eine Sache: Dass wir uns nur dann Erholung erlauben, wenn wir meinen, sie uns verdient zu haben. Nach einem Prüfungsmarathon, einem anstrengenden Arbeitstag oder eben in den Ferien. Aber einfach so? Unverdient? Mitten im Alltag? Schwierig. Immerhin heißt es „erst die Arbeit, dann das Vergnügen“. Ich habe nicht gearbeitet, also steht mir das Vergnügen auch nicht zu. Ohne Leistung keine Belohnung.
Dabei ist Müßiggang durchaus gesund. „Wer sich völlig gegen die Langeweile verschanzt“, wusste schon Nietzsche, „verschanzt sich auch gegen sich selbst.“ Bereits in der Antike galt Müßiggang als eine Tugend, die den Geist befreite und zum produktiven Schaffen befähigte.
Das können Psychologie und Hirnforschung heute bestätigen. Wenn wir aktiv ruhen, schaltet unser Gehirn nicht ab. Im Gegenteil – eine Gruppe bestimmter Areale ist dann besonders aktiv, das sogenannte Default Mode Network. Dieses Netzwerk ist zum Beispiel an der Verarbeitung autobiographischer Erinnerungen oder dem freien Fluss von Ideen beteiligt. Wer die Gedanken auch mal schweifen lässt, fördert also seine Identitätsbildung und Kreativität. Produktive Unproduktivität könnte man das nennen.
Eine Woche später kann ich das Nichtstun zumindest akzeptieren. Ich liege neben meinem Freund im Garten, wieder steht die Sonne tief und wärmt meine Haut. Doch anders als noch vor ein paar Tagen bin ich nicht gestresst. Mein Kopf ist seltsam klar und geordnet. Irgendetwas hat die Stille in mir aufgelockert. Ich hatte Zeit, nachzudenken, über mich, meine Zukunft, meine Sorgen. Alles Dinge, die ich sonst vor mir her schubse. Heute, hier und jetzt, nehme ich mich selbst viel deutlicher wahr. Und kann guten Gewissens sagen: non fare niente è dolce.
Von Anaïs Kaluza