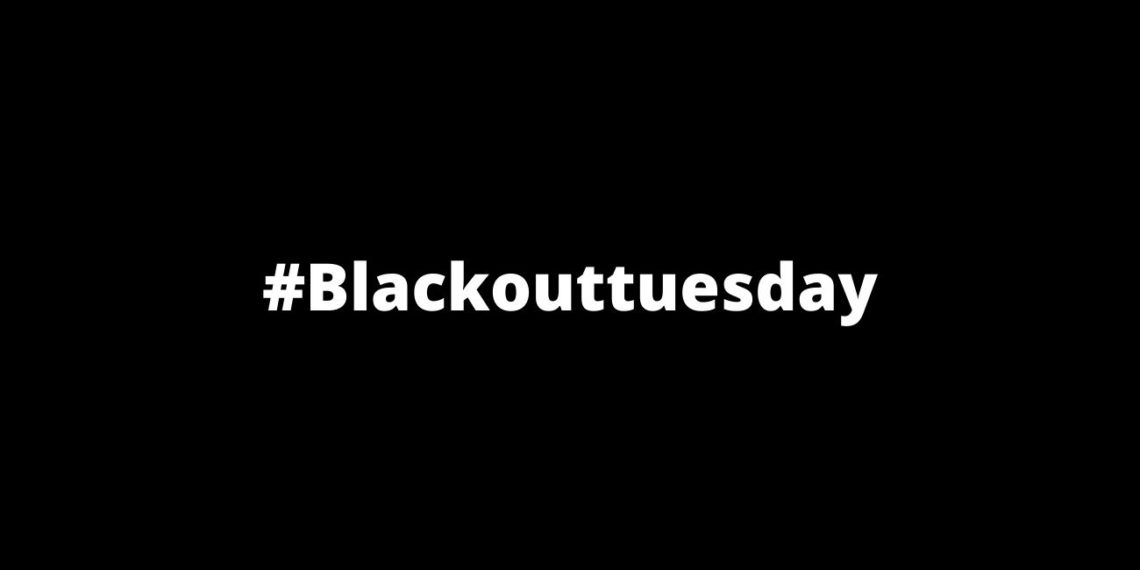Es ist ein gewöhnlicher Vormittag im Juni 2020. Nils liegt noch im Bett und scrollt gleichgültig durch Social Media. In zehn Minuten beginnt seine Online-Vorlesung.
Er öffnet Instagram. Was ist das denn? Sein Feed ist voller schwarzer Quadrate mit dem Hashtag #BlackoutTuesday. Ach ja, es geht um die anhaltenden Proteste gegen Rassismus, die seit dem Tod des US-Amerikaners George Floyd kursieren. Sehr gut, denkt Nils. Natürlich ist auch er gegen Rassismus. Also schnell noch das Bild hochladen und schon beginnt die Vorlesung.
So oder so ähnlich könnte diese fiktive Situation tatsächlich abgelaufen sein. Die Internet-Community hatte sich an jenem Dienstag ein weiteres Mal vereint, um sich gegen einen gesellschaftlichen Missstand zu positionieren. Eine digitale Choreographie mit Signalwirkung. Aber hat sie wirklich etwas bewirkt?
Der #BlackoutTuesday startete ursprünglich als #TheShowMustBePaused auf Initiative von Jamila Thomas und Brianna Agyemang, beide Führungskräfte bei großen amerikanischen Musiklabels. Sie riefen die Musikbranche auf, die weltweit von schwarzen Künstlern mitgetragen wird, für einen Tag den Betrieb zu pausieren, um in den Dialog über interne Ungerechtigkeit zu treten. Mit Erfolg. Über Promis und große Unternehmen wurde die Bewegung bald jedoch weit über die Grenzen der Musikszene hinausgetragen, bis die ursprüngliche Intention nur noch schwer zurückzuverfolgen war. Irgendein Statement gegen Rassismus eben. So weit so gut – wäre da nicht das Phänomen des Bystander-Effekts.
Dabei handelt es sich um ein psychologisch bedingtes Auftreten mangelnder Zivilcourage, sobald eine fremde Person Hilfe benötigt. Das Prinzip ist simpel. Je mehr Leute eine Notsituation beobachten, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einschreitet und hilft. Psychologen erklären dies durch eine Diffusion der Verantwortlichkeit. Je mehr Leute anwesend sind, desto mehr Eigenverantwortung wird abgegeben und desto schwächer ist die Bereitschaft jedes Einzelnen, zu handeln. Beim #BlackoutTuesday zeigte sich eine Art umgekehrter Bystander-Effekt. Zwar bekommt das Thema durch das Teilen zunächst gebührende Aufmerksamkeit, jedoch liegt die Gefahr im „Danach“. Denn ein medialer Aufschrei ist nur ein kleiner Schritt und zudem ein unbedeutender, wenn weiteres Handeln gegen Rassismus ausbleibt.
Wer wirklich etwas bewirken will, sollte mehr tun: zum Beispiel Petitionen unterzeichnen, Spenden, Demonstrieren, Wählen gehen – und das Wichtigste: Einschreiten, wenn es im Alltag zu rassistischen Vorfällen kommt.
Awareness-Hypes auf Social Media kommen und gehen, für Betroffene bleiben sie jedoch Dauerzustand. Belässt man es bei einem Posting, macht man sich selbst zum Bystander. Die gute Nachricht ist: Wer um diesen Bystander-Effekt weiß, kann ihn überwinden. Auch Nils könnte das.
Eine Kolumne von Jonathan Pinell