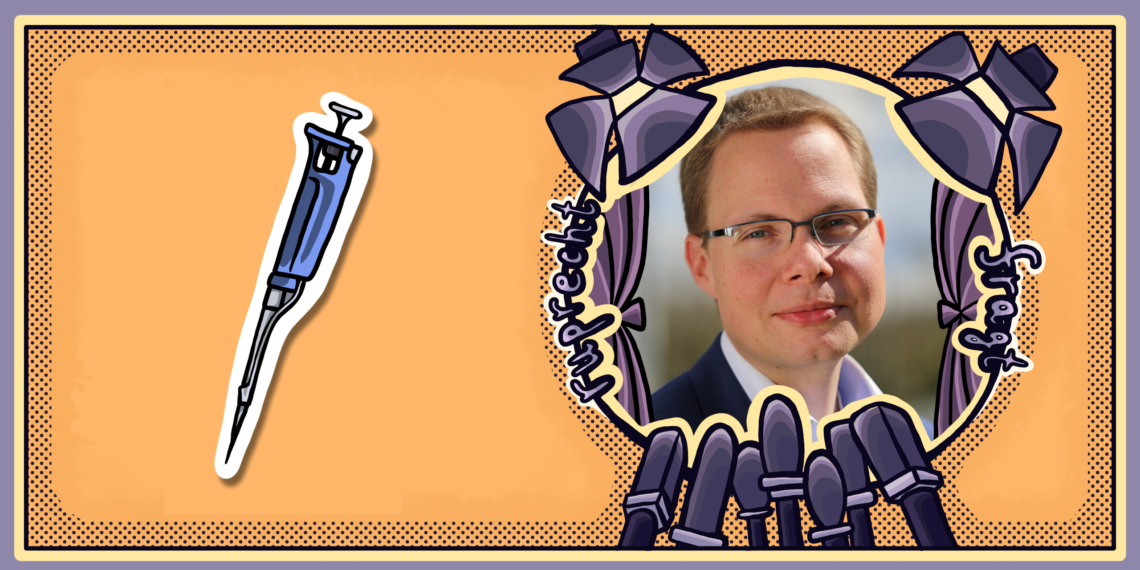Sven ist Professor für Krebsforschung an der Universität Freiburg und Biochemiker am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ). Dort leitet er verschiedene Projekte, um Krebs besser zu verstehen und spezifischere Therapieansätze zu entwickeln. Von seinem Ansporn, Krebsforscher zu werden, der besten Zeit in seiner Karriere und der Frage, ob Krebs irgendwann heilbar sein wird, erzählt er unserer ruprecht-Redakteurin.
Wer bist du, Sven?
Ich bin Sven Diederichs, Biochemiker und Abteilungsleiter am DKFZ Heidelberg. Außerdem lehre und forsche ich als Professor für Krebsforschung an der Uni Freiburg. Mein Team forscht gerade an zwei Projekten: Einerseits untersuchen wir die „dunkle Materie des Genoms“, die sogenannten nicht-kodierenden RNAs und ihre Funktion in Krebszellen, deren Relevanz in der Zelle lange unbekannt war.
Andererseits beschäftigen wir uns mit funktioneller Genomik von Krebszellen. Wir wollen herausfinden, welche Erbgutveränderung dazu führt, dass ein Patient ein bestimmtes Medikament bekommen oder nicht bekommen sollte.
Wieso bist du Krebsforscher geworden?
Naturwissenschaften haben mich schon immer interessiert und als ich angefangen habe, Biochemie zu studieren, war mir ziemlich klar, dass ich später Krebsforschung machen wollte. Das ist auch meiner eigenen, sehr persönlichen Geschichte geschuldet: Ich habe als Kind beziehungsweise Jugendlicher selbst eine Krebserkrankung mit zwei Jahren Therapie durchgemacht. Das hat mich früh geprägt. Das ist eine sehr persönliche Beziehung dazu, auch wenn ich jetzt nicht an derselben Tumorentität forsche, die ich selbst hatte.
Gab es ein spezielles Erlebnis oder eine Station in deiner Laufbahn, die besonders einprägsam für dich war?
Was ich als beste Zeit empfunden habe und auch allen jungen Wissenschaftler:innen empfehlen möchte, ist der Postdoc. Ich war dafür dreieinhalb Jahre an der Harvard Medical School in Boston, was natürlich ein tolles persönliches Erlebnis war, an dem ich viel gewachsen bin, Netzwerke knüpfen und neue Leute kennenlernen konnte. Aber es ist auch eine Zeit, in der man Leistung zeigen muss.
Der Druck, den man sich selbst macht, weil man etwas erreichen möchte, ist natürlich hoch. Dennoch war es rückblickend die beste Zeit, da ich einerseits erfahren genug war, um eigenständig Projekte verfolgen zu können, aber andererseits noch nicht die Verantwortung und die administrativen Pflichten eines Abteilungsleiters hatte. Ich konnte mich dort sehr auf meine Wissenschaft konzentrieren.
Wieso hast du dich dazu entschieden, für deinen Postdoc nach Boston zu gehen?
Während meiner Studienzeit war ich bereits für Praktika in Los Angeles und Stanford. Für meinen Postdoc wollte ich gerne an die Ostküste. Ich wollte an einen Ort, an dem wirklich viel lebenswissenschaftliche Forschung betrieben wird und wo ich viele Methoden und Ideen kennenlernen kann. Ich hatte den Einduck, dass die Uhren in Boston sehr schnell ticken und ich viel für meine weitere Forschung mitnehmen konnte.
Du bist schon recht jung akademisch sehr erfolgreich gewesen, wie ist das zwischen so vielen Älteren?
[Lacht] Das ist ja schon lange her! In meiner ersten eigenen Vorlesung habe ich mich tatsächlich erstmal zwischen die Studierenden gesetzt, ohne dass es aufgefallen wäre und stand dann erst aus deren Mitte auf, als es losging. Ansonsten gab es am DKFZ ja schon einige Nachwuchsgruppen, sodass ich da kein Exot war. Es gab großes Interesse an meiner Forschungsrichtung, neuen Forschungsfragen und Methoden.
Wir haben auf wissenschaftlicher Ebene sehr gut kollaboriert und sogar ein Netzwerk gegründet: „RNA@DKFZ“. Da haben sich viele Leute engagiert, es wurden Konferenzen organisiert und DKFZ-Wissenschaftler:innen, die sich mit RNA-Forschung beschäftigen, haben sich zusammengetan. Aber natürlich gab es auch mal eine Veranstaltung – ich sah auch noch recht jung aus – bei der ein Organisator mich als Einundreißigjährigen ernsthaft fragte, ob ich als Preisträger von Jugend forscht hier sei. Das muss man mit Humor nehmen.
Was in deinem Leben gibt dir den Ausgleich in der Work-Life-Balance?
Das ist ganz einfach: Familie und Fotografie. Ich habe eine Frau und eine Tochter und jede Minute, die ich nicht der Wissenschaft widme, versuche ich mit ihnen zu verbringen. Ich bin auch gerne draußen unterwegs, weil man als Wissenschaftler doch recht viel Zeit sitzend und in geschlossenen Räumen verbringt.
Wir haben eine Rubrik, „Erklär’s mir, als wär’ ich fünf“, in der wir komplexe Themen sehr vereinfacht erklären. Kannst du mir dein aktuelles Forschungsprojekt so erklären, wie du es zum Beispiel deiner Tochter erklären würdest?
Das menschliche Erbgut kann man sich als Kochbuch vorstellen, in dem es ganz viele Rezepte gibt, mit denen man Gerichte kochen, also Eiweiße herstellen, kann. Davon werden in der Zelle nun einzelne Rezepte abgeschrieben – also von der Erbgut-DNA in Boten-RNA transkribiert. Diese abgeschriebenen Rezepte werden dann in ein Produkt umgesetzt – das Rezept der Boten-RNA wird in ein Eiweiß übersetzt. Lange Zeit dachte man, dass die Eiweiße alle wesentlichen Funktionen der Zelle ausführen, also die einzig aktiven Produkte der Kochrezepte sind, und die RNA nur als Kopie des Erbguts der Vermittler zwischen Erbinformation und Eiweißprodukt ist.
In den letzten Jahren ist aber klar geworden, dass die RNA viel mehr kann, als einfach nur Zutaten und Zubereitungsschritte für die Proteine zu speichern. Wir konzentrieren uns dabei besonders auf sogenannte nicht-kodierende RNAs, also RNAs, die gar kein Kochrezept, keinen Bauplan für ein Eiweiß enthalten – aber trotzdem abgeschrieben werden. Diese RNAs sind also quasi abgeschriebene Seiten des Kochbuches „Erbinformation“, die für ein Eiweißrezept keinen Sinn ergeben würden, aber dennoch in großer Zahl abgeschrieben werden und wichtige Informationen enthalten.
Meine Forschung beschäftigt sich damit, was das Kochrezept, also die RNA, darüber hinaus macht, als einfach nur der Bauplan für Eiweiße zu sein. Tatsächlich führt diese nämlich viel mehr Funktionen in der Zelle und auch in der Krebszelle aus, als man sich hätte vorstellen können.
Was glaubst du, was in 15 Jahren im Bereich der Krebsforschung möglich sein wird?
Ich glaube, dass wir die molekularen Mechanismen in der Tumorzelle und in der Interaktion mit den umgebenden normalen Zellen, insbesondere dem Immunsystem, viel besser verstehen werden und dies für neue, zielgerichtete Therapeutika einsetzen können, die auch weniger unerwünschte Wirkungen haben. Es wird Krebsarten geben, die wir viel besser behandeln können als heute und andere, die sich weiterhin nicht so gut behandeln lassen.
Womit sollten sich die Menschen generell mehr beschäftigen und worüber sollte mehr gesprochen werden?
Über Wissenschaft und über unsere längerfristige Zukunft. Zum einen fehlt mir in der öffentlichen Debatte häufig die wissenschaftliche, faktenbasierte Grundlage. Zum anderen habe ich in Deutschland häufig den Eindruck, dass wir uns in der politischen, öffentlichen – oder nur in der veröffentlichten – Diskussion zu häufig mit den kleinen Fragen der Gegenwart beschäftigen, als mit den großen Fragen der Zukunft und deren Lösung. Der Klimawandel ist zwar mittlerweile in aller Munde, aber eine sachliche Diskussion zu kurz- und langfristigen Lösungsmöglichkeiten findet zu wenig statt.
Alle reden über „Klimakleber“, aber zu wenige darüber, wo die Energie kurz-, mittel- oder langfristig konkret herkommen soll. Auch die Alterung unserer Gesellschaft, die möglichen Chancen, aber auch Risiken von KI oder die simple Frage, womit wir unseren Lebensstandard in Deutschland in 20 oder 50 Jahren noch finanzieren möchten, werden meiner Wahrnehmung nach nicht ausreichend diskutiert.
Das Gespräch führte Eileen Taubert.
...studiert Französisch und Germanistik. Seit 2022 schreibt sie für den ruprecht über die kleinen und großen Fragen des studentischen Alltags.