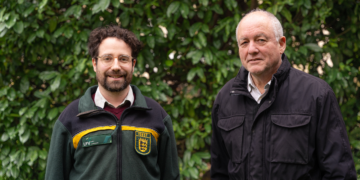Manche von uns kennen ihn – den „Tatort“ im Marstall-Café. Die deutsche Kultserie verzaubert wöchentlich mehr als 11 Millionen Zuschauer:innen. Wir haben uns mit dem Drehbuchautor Thomas Weingartner getroffen
Fangen wir mit der wohl offensichtlichsten Frage an: Wie wird man eigentlich Drehbuchautor einer solch beliebten Krimireihe?
Ich bin „Tatort“-Autor geworden, weil ich Drehbuch studiert habe. Das kann man in Wien an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst, dort gibt es die Filmakademie und den Zweig „Drehbuch“. Ich hab relativ bald, so nach zwei Jahren Germanistikstudium, dorthin gewechselt. Schon zu Studienzeiten hab ich erste Kontakte in der Branche geknüpft und für Privatsender Drehbücher geschrieben. Eigentlich war das bei mir ein ziemlicher Glücksfall, ich konnte relativ nahtlos vom Studium ins Berufsleben wechseln.
Ich hab als Kind viele Krimis geschaut, weil meine Oma ein großer Krimi-Fan war. Das waren damals „Ein Fall für Zwei“ und natürlich auch „Tatort“, aber was mich eigentlich immer am meisten interessiert hat, war die Psychologie der Figuren. Was bei Krimis prinzipiell cool ist, ist, dass man diese Psychologie in einer Extremvariante zeigen kann und mit der schrecklichstmöglichen Tat beginnt, um sich dann schichtweise zum Motiv der Person durchzubohren.
War es am Anfang schwierig, sich über Wasser zu halten, weil man noch keinen Namen hatte?
Sehr viele Leute treten mit dem einzigen Ziel an der Kunstakademie an, später einmal im Kunstfilm- oder Kino-Bereich zu arbeiten. Ich war da ein bisschen anders, vielleicht auch, weil ich so ein Fernsehkind bin. Aber eigentlich war es immer mein Hauptziel, von dem Beruf leben zu können. Ich hab relativ wenig Skrupel gehabt, auch Jobs anzunehmen, die von manchen Kolleg:innen belächelt wurden, um mich auszuprobieren. Mein erster regelmäßiger Job war bei einer Daily Sitcom, die der ORF Anfang der neunziger Jahre produziert hat. Das war wahnsinnig spannend, weil man pro Woche 20-40 Sendeminuten Drehbuch geschrieben und dann eine Woche später schon die fertige Folge gesehen hat. Da ist der Lerneffekt wirklich riesig. Für mich persönlich war das das Beste, was passieren konnte.
Sie schreiben die Drehbücher für den „Tatort“ mit einem Partner. Wie kam es dazu, dass Sie sich kennengelernt haben und dass Sie dann zu so einem eingespielten Team wurden?
Ich schreibe meine Drehbücher gemeinsam mit Stefan Hafner, den ich bereits aus Studienzeiten kenne. Auch wenn wir damals noch nicht zusammengearbeitet haben, gab es schon die Grundidee, gemeinsam etwas zu entwickeln. Der Grund dafür ist, dass der Beruf des Drehbuchautors oft ein sehr einsamer Job ist: Für so eine Drehbuchfassung schreibt man zwei bis drei Monate, vielleicht auch länger. Daher vergeht wahnsinnig viel Zeit bis man Feedback von den Auftraggebenden bekommt und in dieser Zeit kann man sich schnell verirren – sowohl im eigenen Kopf als auch in der eigenen Geschichte. Wenn es funktioniert, würde ich jedem empfehlen, im Team zu arbeiten. Ich höre oft von Kolleg:innen, dass man viel Herzblut in die Arbeit steckt und dann wird, wenn man Pech hat, die Arbeit von mehreren Monaten in einer einzigen Besprechung in der Luft zerpflückt. Das ist schon besser zu nehmen, wenn man zu zweit ist.
Wie läuft der typische Prozess vom Gedanken zur fertigen Folge ab? Erhält man zuerst einen Auftrag, oder kommt zunächst der Entwurf?
Beides ist möglich. Bei uns war es so, dass wir in Österreich als Drehbuchautoren schon ein bisschen etabliert waren, sodass der Sender auf uns zugekommen ist und uns gefragt hat, ob wir nicht Lust hätten, einen „Tatort“ zu schreiben. In diesem Fall für das Ermittlerteam Moritz Eisner und Bibi Fellner. Die Figuren kennt man in so einem Fall dann natürlich schon. Trotzdem schaut man nochmal alle „Tatort“-Folgen von dem Gespann, auch, um sich ein bisschen in den Sprachduktus der Kommissar:innen einzuhören. Es ist aber auch durchaus möglich, sich mit einem eigenen Vorschlag an Redaktionen zu wenden.
Für wie viele Städte haben Sie schon geschrieben? Ist es für Sie eine Herausforderung, ein Gefühl für eine neue Stadt zu bekommen?
Wir haben zwei „Tatorte“ für Wien geschrieben und beginnen jetzt mit einem dritten. Dann einen für München und nun haben wir das Konzept für ein neues Ermittlerteam entwickelt, das heuer (dieses Jahr, Anm. d. Red.) startet. Ein Gefühl für die Stadt zu bekommen, ist eine der schwierigsten Aufgaben, weil wir schon einen „Tatort“ schreiben wollen, der den Flair und die soziale Struktur der Stadt einfängt.
Inspirieren Sie sich bei den Fällen an sich an realen Geschehnissen oder auch an anderen Krimis?
Das ist schwer zu sagen. An bereits bestehenden Krimis nicht, der Anspruch ist schon, einen Fall von Grund auf neu zu entwickeln. Aber natürlich leben wir in einer Welt, in der man Nachrichten liest, da sickert sicher auch das eine oder andere durch.
Beim München-„Tatort“ wollten wir von einem Mord erzählen, der von einem Jugendlichen ohne greifbares Motiv begangen wird. Dabei hat uns vor allem interessiert: Wie reagiert die Familie auf so eine unfassbare Tat? Das sind oft Ideen, wo man sich denkt, da würde man gerne mal nachforschen. Dann recherchieren wir. Es gibt also erst die Idee, von der man hofft, dass sie originell ist und einen 90-Minuten-Krimi trägt, und dann fängt man an, sich da tiefer reinzugraben.
Beziehen Sie bei der Detailrecherche auch Expert:innen mit ein?
Wenn sich die Psychologie in einem Spektrum bewegt, das wir glauben, nachvollziehen zu können, dann passiert das zwischen meinem Kollegen und mir. Aber wenn es in Richtung psychischer Krankheiten oder Störungen geht, dann sprechen wir natürlich mit Experten. Diese „Tatorte“ werden von wahnsinnig vielen Leuten gesehen und da hat man natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Der größte Teil der Arbeit passiert aber zwischen meinem Kollegen und mir. Schon allein den Fall und die Figurenkonstellationen so aufzustellen, dass spannende Wendungen möglich sind, dauert seine Zeit, und dann muss man das Ganze nochmal aus Ermittlersicht neu stricken. Es gibt aber auch ein paar dramaturgische Grundregeln, die sich bewährt haben und gut funktionieren.
Das Gespräch führte Elena Lagodny
...studiert Biowissenschaften, schreibt seit WS 2023 für den Ruprecht und nutzt Interviews als Grund um mit interessanten Leuten zu reden