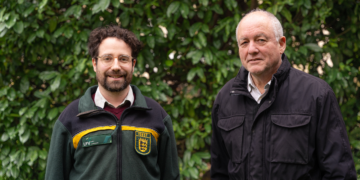Dieses Jahr jährt sich zum hundersten Mal der Ausbruch des Ersten Weltkriegs (siehe auch „Halblauter Jubel“). Auch in der Literatur hat dieser Krieg seine Spuren hinterlassen. Helmuth Kiesel, Dozent am Germanistischen Seminar, ist spezialisiert auf die deutschsprachige Literatur des 20. Jahrhunderts und insbesondere der Jahre 1918 bis 1945 und forscht unter anderem international anerkannt zu Ernstr Jünger. Wir sprachen mit ihm über dessen Kriegsbuch „In Stahlgewittern“, eine kriegsbegeisterte Autorengeneration und die Verarbeitung des Krieges in der Literatur.
Herr Kiesel, dieses Jahr jährt sich zum hundertsten Mal der Erste Weltkrieg. Wie wurde dieses Ereignis in der deutschen Literatur verarbeitet?
Die Frage, wie der Erste Weltkrieg in der deutschen Literatur verarbeitet wurde, lässt sich nicht kurz beantworten, denn es sind eine Reihe von großen, bedeutenden Werken erschienen, die den Ersten Weltkrieg als ein epochales Ereignis dargestellt haben. Einige dieser Werke kamen kurz nach dem Krieg, wie Ernst Jüngers Kriegsbericht „In Stahlgewittern“, der erstmals 1920 gedruckt wurde. Die meisten dieser Werke erschienen aber 10 Jahre nach dem Weltkrieg, also ab 1928/29 und in den folgenden Jahren. Man sprach schon damals von einer „Wiederkehr des Weltkriegs in der Literatur“. Damals sind die großen Weltkriegsromane entstanden, wie Erich Maria Remarques „Im Westen nichts Neues“ oder Ludwig Renns „Der Krieg“ und andere, die den Weltkrieg aus der Erfahrung von Kriegsteilnehmern dargestellt haben – ein großer Teil der Autoren war im Krieg an verschiedenen Fronten und in verschiedenen Funktionen eingesetzt worden. Es gibt aber auch Romane, etwa Siegfried Kracauers „Ginster“ und Ernst Glaesers „Jahrgang 1902“, beide von 1928, die den Krieg aus der Sicht von jüngeren Menschen schildern, die nicht als Soldaten in den Krieg kamen, sondern die Kriegszeit zuhause verbrachten und auf diese Weise erlebten, wie sich der Krieg auf das zivile Leben in Deutschland auswirkte. Deutschland war ja, anders als Frankreich oder Polen und Russland, nicht Frontgebiet, abgesehen von Ostpreußen. Trotzdem hat der Krieg natürlich auch in Deutschland schwere Folgen gehabt, etwa Versorgungsengpässe, Mangelernährung, Krankheiten, Gütermangel aller Art, den Ausfall eines großen Teils der arbeitsfähigen Männer, was zur Folge hatte, daß viele Frauen schwere Arbeit verrichten mußten.
Wie wurde die Kriegserfahrung in der Literatur dargestellt und bewertet?
Die Kriegsliteratur ist da in, grob gesagt, zwei Gruppen gespalten, die sich aber in vieler Hinsicht auch berühren. Man könnte sagen, es gibt eine kriegsaffirmative Literatur, die man auch kriegsidealistisch oder bellizistisch nennen könnte. Das ist meist Literatur von ehemaligen Frontsoldaten, die den Krieg nicht nur als etwas durch und durch Böses, Verwerfliches verurteilen, sondern versuchen, mit ihren Erlebnissen in irgendeiner positiven Weise für sich fertig zu werden, ihnen einen Sinn zu geben. Es ist für einen Menschen nur schwer erträglich, dass er drei oder vier Jahre derartige Dinge miterlebt haben sollte, ohne dass sie irgendeinen positiven Sinn gehabt hätten. Also wird versucht, den Krieg als einen Modus der geschichtlichen, politischen Auseinandersetzung unter Menschen darzustellen, ihm bestimmte Ziele zuzuschreiben, die vertretbar erschienen – damals! aus heutiger Sicht wird man das anders beurteilen –, aber von den Kriegsteilnehmern ist das so gesehen worden. Das ist sinngebende oder kriegsaffirmative Literatur, die auch kriegsidealistisch, insofern sie sagt: Das Soldatsein gehörte schon immer zum geschichtlichen Leben und galt als heldenhafte Leistung fürs Vaterland; der Kriegseinsatz ist deswegen nicht ethisch Verwerfliches oder gar Verbrecherisches, sondern etwas, zu dem man sich bekennen konnte, ja für das man sich rühmen durfte. Bellizistisch bedeutet, dass man der Meinung ist, dass Kriege aus der Geschichte und aus dem politischen Handeln der Völker nicht wegzudenken sind und dass man sich deswegen in jeder Gesellschaft, in jeder Kultur auf den Krieg vorbereiten und wappnen müsse. Das ist also die Literatur, die man als affirmativ, kriegsidealistisch oder bellizistisch bezeichnen kann. Und auf der anderen Seite gibt es dann die pazifistisch intendierte Literatur, die zeigen will, dass der Krieg nicht nur ein großes Unglück war – was er ganz zweifellos war –, sondern ein Verbrechen an der Menschheit, verbunden mit ungeheuren Gräueln, Kriegsverbrechen, Inhumanitäten und einer unfaßbaren Zahl von toten Soldaten und Zivilisten. Das ist ja bekannt und, wenn man auf die Ursachen des Ersten Weltkriegs blickt, der ja durchaus zu vermeiden gewesen wäre, zur Anklage geradezu zwingend.
Es ist für einen Menschen nur schwer erträglich, dass er drei oder vier Jahre derartige Dinge miterlebt haben sollte, ohne dass sie irgendeinen positiven Sinn gehabt hätten.
Nun ist aber interessant, dass diese beiden Literaturen, also die kriegsaffirmative und die pazifistische Literatur, sich durchaus berühren. Indem sie nämlich beide den Krieg detailliert und eindringlich darstellen, auch das Leid der Soldaten zeigen, wird der Krieg nicht nur in der pazifistischen, sondern auch in der affirmativen Literatur als etwas Unheilvolles erkennbar. Und in diesem Sinn wurden etwa die Kriegsbücher von Ernst Jünger, die kriegsaffirmativ intendiert waren, um 1930 gerade von pazifistischen, linken Intellektuellen als kriegskritische, ja sogar pazifistische Bücher gelesen. Erich Maria Remarque hat 1929 in einem Interview mit einer französischen Zeitung gesagt, die Kriegsbücher von Ernst Jünger seien zusammen mit Ludwig Renns „Krieg“ diejenigen, die – wörtlich – „am meisten pazifistisch“ wirken. Und Paul Levi, ein jüdischer Rechtsanwalt aus Frankfurt am Main, der 1919/20 Vorsitzender der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) war und seit 1924 Reichstagsabgeordneter der SPD war, hat 1930 in einer Rezension über die „Stahlgewitter“ geschrieben, dass kein Buch eine stärkere Anklage gegen den Krieg enthalte als dieses Buch eines Mannes, so Levi, der zum Krieg positiv eingestellt war. Ähnlich äußerte sich auch der jüdischer Autor Hans Sochaczewer, der heute nicht mehr bekannt ist, aber um 1930, zwei Romane über die Nachkriegsmentalität geschrieben und zur Vorbereitung die Bücher Ernst Jüngers gelesen hat. Er sagte, dass der pazifistische Ruf „Nie wieder Krieg!“ am lautesten aus den Büchern von Jünger spreche. Andererseits können wir 1931 in der „Weltbühne“, einer renommierten linken Zeitschrift, lesen, dass Erich Maria Remarques „Im Westen nichts Neues“ – wiederum wörtlich – „pazifistische Kriegspropaganda“ sei, weil der Krieg auch in diesem Buch als etwas Abenteuerliches dargestellt wird, als etwas Faszinierendes, in dem positive Erlebnisse verschiedener Art möglich sind, Kameradschaft, Rebellion gegen Vorgesetzte, auch Liebesaffären mit Französinnen und Ähnliches. Damit will ich diese beiden Literaturen nicht gleichsetzen. Sie sind intentional verschieden und haben unterschiedliche Effekte, aber sie berühren sich auch. Und was man letztlich aus diesen Büchern herausliesßt, das hängt immer ganz stark auch vom Leser ab.
Das heißt, die Bücher sind auch anders gedeutet worden, als es ursprünglich intendiert war?
Ja, die Bücher sind anders rezipiert worden, als sich die Autoren das vorgestellt haben. Jünger wollte ein kriegsaffirmatives Heldenbuch schreiben, tatsächlich hat er ein Buch geschrieben, das vor allem das Leid und das Elend der Soldaten zeigt, und deswegen ist dieses Buch auch als kriegskritisch und pazifistisch gelesen worden. Remarque wollte ein anklägerisches, pazifistisches Buch schreiben, aber er hat, weil er genötigt war, den Krieg glaubhaft darzustellen, ihn eben auch so gezeigt, dass von diesem Buch eine gewisse Faszination für Abenteurer ausgegangen ist. So kam dann auch die „Weltbühne“ zu ihrer Kritik, weil Gefahr immer faszinierend und aufreizend ist.
Die Bücher sind anders rezipiert worden, als sich die Autoren das vorgestellt haben.
Wie glaubwürdig sind dann Bücher wie Ernst Jüngers „In Stahlgewittern“, wenn sie mit einer klaren politischen und ideologischen Zielsetzung geschrieben wurden?
Die „Stahlgewitter“ haben keine politische und dezidiert ideologische Zielsetzung. Jünger hat sich 1914 als Abiturient mit 19 Jahren freiwillig zum Militär gemeldet, kam dann am 30. Dezember 1914 zum Fronteinsatz nach Frankreich. Ein Jahr vorher, 1913, war er bereits aus der Schule geflüchtet, in die Fremdenlegion, doch hat ihn sein Vater wieder zurückgeholt. Jünger wollte ein großes Abenteuer, ob Fremdenlegion oder Krieg, das war ihm relativ egal. Er hatte keinerlei politische Interessen, er hatte keine Vorstellungen vom „Krieg der Kulturen“ oder von möglichen deutschen Kriegszielen wie Raumgewinn im Westen und Osten. Das alles war ihm völlig gleichgültig, er wollte nur in den Krieg, um ein großes Abenteuer zu erleben. Trotzdem hat er sich dann im Krieg bemüht, sich als Soldat zu bewähren und ein vorbildlicher Kompanieführer zu werden, ein „Krieger“, wie er zu sagen pflegte, und „Held“ im vollen, begeisterten und emphatischen Sinn dieses Wortes. Aus dieser Sicht schreibt er nieder, was er erfahren und erlebt hat. Ohne Rücksicht auf die Frage, wofür dieser Krieg geführt wird oder wozu er gut sein könnte. Es ist also ein Erlebnis- und Tatsachenbericht, der nicht ideologisch gefärbt ist. Nun kann man natürlich sagen, auch die Vorstellung, dass man den Krieg als „reinen“ Krieg führen könne, und nach den politischen Zielen nicht fragen müsse, ist eine Ideologie, nämlich die Ideologie des Unpolitischen. Aber zunächst einmal muss man festhalten, das die „Stahlgewitter“ primär auf die reine, sachliche Darstellung der Kriegserfahrung aus sind. Deswegen gibt es bei Jünger beispielsweise auch keine politischen Überlegungen oder chauvinistische Darstellungen. Er hasst weder die Franzosen noch die Engländer, sie sind für ihn Gegner, die er natürlich auch auszuschalten trachtet, die er auch tötet;, aber das geschieht nicht mit nationalistisch motiviertem Hass, sondern im Sinne einer militärischen Logik, die das „Ausschalten“ des Gegners einfach verlangt. Auch das, was damals als „schwarze Schmach“ bezeichnet wurde, das rassistische Argument, die Franzosen hätten keine afrikanischen Truppen gegen Deutsche kämpfen lassen sollen, taucht bei Jünger nicht auf. Die Gegner sind ebenbürtige Gegner, die nicht Verachtung oder Hass verdient haben, sondern Achtung, „Ritterlichkeit“, wie Jünger auf eine anachronistisch wirkende Weise auch sagt, und im Fall der Gefangennahme Schutz und Fürsorge.
Aber es wird dem Buch auch häufig vorgeworfen, den Krieg zu idealisieren und Gewalt zu ästhetisieren.
Das Buch idealisiert den Krieg insofern als es sagt, dass der Krieg zur geschichtlichen Auseinandersetzung unter den Menschen, Völker und Kulturen immer gehört hat und vermutlich auch weiterhin gehören wird und dass deswegen Krieg oder Kriegertum etwas ist, das seine eigene Qualität, seinen eigenen Wert und, wenn man so will, seine eigene Idealität hat. Das ist das Denken der sogenannten heroischen Epochen unserer Geschichte, als Krieger, Priester und Bauern die drei wesentlichen gesellschaftliche Ständen ausmachten, und niemand den Ritter als etwas Böses verurteilt hat, sondern als Schützer der der Sicherheit und Ordnung, des Glaubens und der Kultur anerkannt hat. Wir müssen uns klarmachen, dass Jünger nicht in unsere post-heroische, pazifistisch geprägte Zeit hineingeboren wurde, sondern ein Kind der heroischen Tradition ist. Die europäische Literatur bis zum Ersten Weltkrieg, ist in hohem Maß heroische Literatur, auch wenn es schon früher pazifistische Literatur gab. Unsere große Dichtung von Homer bis zu den großen Romanen des 19. und 20. Jahrhunderts ist heroische Literatur, die von Heldentaten spricht. Dazu gehört auch das bellizistische Denken, das besagt, dass eine Nation oder eine Kultur selbstverständlich für ihre Ziele Krieg führen dürfe. Einen Krieg zu führen, auch einen Krieg zu beginnen, galt bis zum Beginn des 20. Jahrhundert nicht gleich als Kriegsverbrechen, sondern als das Recht der Völker. Und da man in Deutschland der Meinung war, dass einem der Krieg aufgezwungen worden sei, gab es auch für Jünger keinen Grund, von dieser kriegsidealistischen und bellizistischen Meinung abzuweichen. Später, in den 1930er Jahren, wird das anders. In den „Marmorklippen“ von 1939 hat sich Jünger von diesem bellizistischen und kriegsidealistischen Denken verabschiedet; die beiden Helden der „Marmorklippen“, hinter denen Ernst Jünger und sein Bruder Friedrich Georg deutlich zu erkennen sind, haben die Waffen abgelegt und greifen in die geschilderten Kämpfe nicht mehr ein.
Unsere große Dichtung von Homer bis zu den großen Romanen des 19. und 20. Jahrhunderts ist heroische Literatur, die von Heldentaten spricht. Dazu gehört auch das bellizistische Denken.
Generell ist die Wahrnehmung Jüngers sehr widersprüchlich: Er gilt als einer der Vordenker der „konservativen Revolution“, hat sich aber 1930 vom Faschismus distanziert, weil er ihm zu totalitär war. Dennoch wird er gelegentlich als Vorkämpfer des Nationalsozialismus bezeichnet. War er das?
Jünger war nie ein Nationalsozialist, sondern ein Nationalist. Das muss man ganz deutlich unterscheiden. Er war der Meinung, dass die Nation als politische Größe eine geschichtliche Rolle spielen müsse und dass sie sich deshalb auch als Nation formieren müsse. Dazu gehörte Wehrhaftigkeit, aber auch sozialer Ausgleich und Pflege einer nationalen Kultur. Auch das sind Dinge, von denen er sich im Lauf der 1930er Jahre verabschiedet hat, aber in den 1920er Jahren war er der Vertreter eines solchen Nationalismus. Alle wesentlichen Elemente, die konstitutiv sind für die nationalsozialistische Ideologie, fehlen dagegen bei ihm, zum Beispiel der Rassismus. – Jünger war kein Rassist, sondern hatte als Zoologe, eine große Wertschätzung für alle Lebewesen und alle Differenzen unter der Lebewesen, natürlich auch unter Ethnien und Kulturen. Es war ihm völlig unverständlich, dass man bestimmte „Rassen“ oder Völkerschaften ausrotten wollte. In seiner bedeutenden, zukunftsvisionären Schrift „Der Arbeiter“ von 1932 wird eine neue Weltordnung, mit einer gerechten Weltwirtschaftsordnung, postuliert, und ausdrücklich gesagt, dass Völkerschaften, die dem modernen zivilisatorischen Leben nicht gewachsen sein sollten, unter Reservatrechte gestellt werden, also geschützt werden müssen. Auch die Vorstellung, daß Deutschland ein „Volk ohne Raum“ sei und sich deswegen nach Osten ausdehnen müsse, spielt bei Jünger keine Rolle. Ebensowenig war er der Meinung, daß ein „Führerwille“ über alles gehe und an kein Recht gebunden sei, den Rechtsstaat liquidieren dürfe. Wesentliche Elemente der NS-Ideologie fehlen also in Jüngers Denken. Um 1930 war er befreundet mit dem Nationalbolschewisten Ernst Niekisch – Nationalbolschewismus ist eine Richtung gewesen, die den Sozialismus im Rahmen der Nation herstellen wollte, ohne Weltrevolution, aber mit Revolution innerhalb der Nation – und diesem Denken hat sich Jünger angenähert.
Überhaupt ist auffällig, dass viele Künstler und gerade auch Schriftsteller den Ersten Weltkrieg anfangs durchaus mit Begeisterung gesehen haben, darunter auch viele, die sich später davon distanziert haben. Woran liegt das?
Dafür gibt es verschiedene Gründe. Es geht dem Ersten Weltkrieg, zumindest in Zentraleuropa, also Deutschland, Frankreich und England, eine lange Friedensperiode voraus, in der man in Deutschland in Wohlstand und Sekurität leben konnte, allerdings auch stark eingeengt war durch die Perfektionierung der bürgerlichen Gesellschaft mit allen ihren Institutionen. Vor allem die junge Generation fühlte sich außerordentlich gegängelt. Zudem muss man sehen, dass die junge Generation ja damals extrem stark war; die Jahrgänge, in die Ernst Jünger hineingeboren wurde und die auch die Expressionistengeneration ausmachen, also die Generation der um 1895 Geborenen, waren die geburtenstärksten Jahrgänge, die Deutschland jemals hatte. Und diese junge Generation voller Möglichkeiten, finanziell teilweise gut ausgestattet durch begüterte Elternhäuser, darauf trainiert, ein eigentlich expansives Leben zu führen, diese junge Generation fühlte sich permanent an Grenzen stoßen und hat sich deshalb nach einem großen Abenteuer wie dem Krieg geradezu gesehnt. Mit dem Krieg schien das Unerhörte, Befreiende, Entgrenzende zu kommen, in dem man sich auch bewähren konnte: Nicht mehr nur die Schulbank drücken, nicht mehr nur in der studentischen Verbindung fechten, sondern auf Leben und Tod kämpfen. Die große Gefahr, das große Abenteuer, die große Entgrenzung – gerade auch die Künstler haben sich danach gesehnt, etwas zu erleben, was sie aus der einengenden bürgerlichen Kultur hinauskatapultieren und ihnen ganz neue Ansichten von Welt und Leben verschaffen könnte. Deshalb haben sich die Künstler auch zum großen Teil freiwillig zum Krieg gemeldet, nicht nur die, die dann auch tatsächlich in den Krieg gekommen und – zu einem großen Teil – auch dort gefallen sind, sondern auch eine Reihe der bedeutenden, namhaften pazifistischen Künstler jener Zeit. Hugo Ball beispielsweise, der im Protest gegen den Krieg in Zürich den Dadaismus kreiert hat, hatte sich auch freiwillig zum Krieg gemeldet. Sogar Franz Kafka hat sich freiwillig gemeldet. So könnte man noch eine ganze Reihe von Autoren anführen, die wir als Pazifisten kennen und schätzen, obwohl sie sich zunächst einmal freiwillig zum Kriegsdienst meldeten. Die jungen Künstler haben sich unter dem Krieg auch etwas ganz anderes vorgestellt, nämlich glanzvolle Feldschlachten mit heldenhaften und ritterlichen Kämpfen Mann gegen Mann. Dann aber waren sie dem modernen Vernichtungskrieg ausgesetzt, den Materialschlachten, in denen die unsichtbare gegnerische Artillerie der Hauptfeind war. 75 Prozent der Ausfälle waren Ausfälle durch Artilleriebeschuss. Die meisten Gefallenen sind nicht im unmittelbaren Kampf mit Gegnern zu Tode gekommen, sondern wurden durch Artilleriegeschosse zu „Brei und Klumpen“ geschlagen, wie es – ebenso erschütternd wie drastisch – in Stefan Georges Gedicht „Der Krieg“ von 1917 heißt. Unter dem Eindruck dieser furchtbaren, modernen Tötungsmaschinerie sind diese Künstler dann relativ rasch zu Kriegskritikern und, zu Pazifisten geworden.
Diese junge Generation fühlte sich permanent an Grenzen stoßen und hat sich deshalb nach einem großen Abenteuer wie dem Krieg geradezu gesehnt.
Wie wurde das nach dem Krieg aufgenommen? Hat man diese Literatur angenommen? Oder hat man versucht, den Krieg zu verdrängen?
Nach dem Krieg gab es, wie gesagt, zunächst einmal einige respektable literarische Kriegsdarstellungen, neben Jünger etwa das eine oder andere Buch von Franz Schauwecker, der zwar zu den Autoren gehört, die man heute sehr kritisch betrachtet, gleichwohl aber zunächst einmal ein durchaus aufschlussreiches und bemerkenswertes Kriegsbuch geschrieben hat. Auch eine Reihe von pazifistischen Kriegsbüchern, beispielsweise „Feuer“ des französischen Autors Henri Barbusse oder Leonard Franks „Der Mensch ist gut“ gehören zu den frühen Werken. Diese Bücher sind zwei, drei Jahre auf dem Markt gewesen, dann sind sie verschwunden, weil die Menschen damals genügend andere Sorgen hatten, man denke nur an die Inflation, und nicht immer mit dem Krieg konfrontiert werden wollten. Unter den Verlegern gab es damals die Devise, dass Manuskripte von Kriegsbüchern sozusagen ungelesen zurückzugeben seien. Und das hat sich erst 1928 geändert, zehn Jahre nach dem Krieg. Da war wohl der Zeitpunkt gekommen, dass Autoren und Verleger das Gefühl hatten, über den Krieg müsse nochmal geredet werden. Die Dekade war offensichtlich die Distanz, die man brauchte, um sich mit dem Krieg erneut und auf eine andere Weise zu beschäftigen. Das gilt auch für Ernst Jüngers „In Stahlgewittern“. Von 1920 bis 1929 sind ungefähr 30 oder 40 000 Exemplare erschienen, das ist nicht allzu viel. 1929 werden die Literaten und das Feuilleton auf das Buch aufmerksam, rezensieren es mit zehnjähriger Verzögerung, und dann kommen größere Auflagen. Bis 1934 werden etwa 60 000 Exemplare verkauft, was aber immer noch sehr wenig ist gegenüber dem ungeheuren Erfolg von „Im Westen nichts Neues“. Innerhalb eines Jahrzehnts, von 1920 bis 1930, wurden eine Millionen Exemplare verkauft, bis 1933 wahrscheinlich 2,5 Millionen, bis heute 16 bis 20 Millionen. Der weltweite Absatz von Jüngers „In Stahlgewittern“ liegt bei etwa 400 000.
Welche welche literarischen Verarbeitungen des Ersten Weltkriegs würden Sie empfehlen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Eigentlich meine ich, sind die beiden Klassiker zum Ersten Weltkrieg in der deutschen Literatur, sowohl was die Dignität angeht als auch im Hinblick auf die unterschiedliche Intentionalität und gleichzeitige Affektivität, Ernst Jüngers „Im Stahlgewitter“ und Erich Maria Remarques „Im Westen nichts Neues“. Es sind auch die beiden deutschen Kriegsbücher, die weltweit die größte Resonanz erzeugt haben. Jünger hat mit dem Titel seines Buches (den er vermutlich von Hermann Stehr übernommen hat) die weltweit wohl am meisten benutzte Metapher für die Beschreibung des Ersten Weltkriegs in seiner militärischen Eigenart geliefert. Und nicht nur dies: In der internationalen militärgeschichtlichen Literatur über den Ersten Weltkrieg wird in auffallender Häufigkeit auf die sachlich präzisen und zugleich emotional eindrucksvollen Darstellungen Jüngers zurückgegriffen. Und „Im Westen nichts Neues“ ist überhaupt das berühmteste deutsche Kriegsbuch. Diese beiden sollte man vielleicht einfach einmal parallel lesen. Dann würde ich auch Arnold Zweigs „Streit um den Sergeanten Grischa“ nennen, unbedingt aber auch den weniger bekannten, aber hochinteressanten Kriegsroman, „Heeresbericht“ von Edlef Köppen, 1930 erschienen, der nicht nur den Frontbereich zeigt, sondern auch das Leben in Deutschland, an der Heimatfront sozusagen, und der in einer literarisch sehr wirkungsvollen Montagetechnik verschiedenen Kriegserfahrungen verbindet. Auch ausländische Literatur würde ich betrachten. Von dem englischen Autor Robert von Ranke-Graves, der mütterlicherseits von dem berühmten Historiker Leopold von Ranke abstammt, wie Ernst Jünger Jahrgang 1895 war und sich ebenfalls freiwillig gemeldet hatte, haben wir das Buch „Goodbye to All That / Strich drunter“ (1930). Es ist ein autobiografisches Kriegsbuch, interessant und lesenswert, weil es verschiedene Parallelen zu Jüngers „Stahlgewittern“ aufweist und weil man sehen kann, wie ein englischer Soldat mit dem Umstand umgeht, dass ihm an der Somme beispielsweise deutsche Verwandte, Onkel und Vetter, gegenüberstehen. Auch „Feuer“ von Henri Barbusse möchte ich natürlich noch einmal erwähnen und empfehlen.
Das Interview führte Michael Abschlag