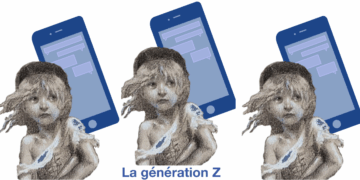Vom Studentenleben an britischen Universitäten
Ein Direktor mit silbernem Zepter; ältere Kommilitonen, die Quidditch spielen und Mama und Papa genannt werden und Historiker, die Finanzmanager werden. Noch vor kurzer Zeit glaubte ich, „Universität“ bedeutete auf der ganzen Welt das Gleiche. Ein Irrtum? „Ihr seid jetzt Teil einer Gemeinschaft!“, sagt der Rektor in seiner Eröffnungsrede, die Dozenten bei den Einführungsveranstaltungen und all meine Orientierungsbroschüren. Nie wird vergessen zu betonen, wie elitär diese Gemeinschaft ist. Der Rektor zählt in seiner Rede Nobelpreisträger und Olympiamedaillen-Gewinner auf und erinnert an die Plätze der University of Edinburgh in den globalen Uni-Rankings. Dann aber pausiert er mit den Worten: „Ihr wisst nicht, wen ihr in zehn Jahren heiraten werdet“ und gibt den Erstsemestern die Möglichkeit, ihre Sitznachbarn kennen zu lernen. Ein Scherz? Vielleicht. Die „Freundes- oder „Familienfindung“ durch die Universität aber ist keiner. In den meisten Wohnheimen wird jeden Tag zur gleichen Zeit gemeinsam gefrühstückt und zu Abend gegessen; in den Einführungsveranstaltungen bekommen die neuen Studierenden Mamas, Papas, Onkel und Tanten aus höheren Semestern zugewiesen. Die diversen Clubs bezeichnen sich oft selbst als „inzestuöse Familien“. Zu intensivem „Socialising“ wird den Erstsemestern sogar eine ganze Woche Zeit gegeben. Gelegenheit, Menschen aller Studienfächer und Interessen zu treffen. In dieser Woche finden keine Vorlesungen, dafür aber zu jeder Tages- und Nachtzeit mindestens drei Veranstaltungen gleichzeitig statt: vom Tea- und Haggis-Tasting bis zu Kostüm-Parties. Der Spaß für die Erstsemester ist groß. Der Druck, möglichst schnell viele Freunde zu finden, auch.
Lucy, Physikstudentin im ersten Semester, lehnt auf einer Party der Student-Union etwas verloren an der Wand: „Ich bin eigentlich so müde, aber ich kann es mir einfach nicht leisten, jetzt schlafen zu gehen.“ Dann klebt sie sich eine Flasche Cider an die Hände, um die anderen Partygäste zu beeindrucken. Innerhalb weniger Tage lerne ich hier so viele Menschen kennen, wie in Heidelberg in Monaten. Die meisten jedoch sehe ich nie wieder. Auf einer Toilettentür im Student-Union-Gebäude steht groß mit schwarzem Marker geschrieben: „I’m so socially exhausted“. Das „Socialising“ hört mit der „Freshers-Week“ aber nicht auf. Der Hauptgrund dafür sind die „Societies“. Wie abwegig die eigenen Interessen und Hobbys auch sein mögen, an einer Universität mit mehr als 30?000 Studierenden finden sich Gleichgesinnte. So gibt es in Edinburgh mehr als 200 dieser von Studierenden organisierten Clubs. Das ist selbst für britische Verhältnisse eine beträchtliche Anzahl. Alle Fächer, Länder, Hobbys, Vorlieben sind vertreten.
Wie Samuel, Austauschstudent aus Deutschland, berichtet, sind die Societies teilweise Vorwand zum kollegialen Trinken. „Ja, man redet ein wenig über Geschichte in der History Society. Dann geht man in eine Bar“, sagt er. Teilweise verschreiben sie sich gleich dem Alkohol, wie die Whisky- oder die Wein-Society oder einem anderen „Guilty Pleasure“, wie es die Schokoladen-Society in ihrer Werbung schreibt. Die meisten Clubs aber zeichnen sich durch unglaubliches Engagement ihrer Mitglieder und perfekte Organisation aus. Sie haben eigene Komitees mit Veranstaltungsorganisatoren, Marketing-und Businessleitern. Das gilt für die Harry-Potter-Society und den Baking-Club genauso wie für die zahlreichen sozialen und ökologischen Societies. In eisiger Kälte stehen die Mitglieder eines Whole-Food-Clubs vor der Bibliothek und verkaufen regionales Bio-Gemüse zu günstigen Preisen. Sie stehen in einer Reihe mit Kuchen-und Keks-Verkäufern, die Geld für wohltätige Zwecke oder Kulturveranstaltungen sammeln. Letztere sind so zahlreich wie die Societies selbst: von African-Carribean-Nights, Charity-Filmvorführungen, Poetry-Slams, über zahlreiche Konzerte bis hin zu Theateraufführungen. Einige der Clubs besitzen gar eigene Gebäude, wie die Theater-Society, die dort 40 Stücke pro Jahr aufführt.
Wie groß die Professionalität ist, bemerke ich erst, als ich bei einer Generalversammlung dieser Society anwesend bin. Vier Stunden lang stellen Regisseure mit ihrem Team aus Produzenten, Bühnenbildnern und Technikern Vorschläge für Shows vor, dann wird abgestimmt. Alles verläuft streng nach den Richtlinien der Konstitution. James, Teil des Komitees, meint: „Ich verbringe hier so viel Zeit wie möglich.“ Zeit mag tatsächlich ein Faktor für das große Engagement sein. Die Studierenden sind hier nicht als Tutoren in das Universitätssystem eingebunden. Vielleicht hat es mit dem zu tun, was der Theater-Business-Manager abschließend sagt: „Was wichtig ist, sind die Skills, die die Studierenden hier lernen.“ Das Wort „Skills“ hört man hier ständig – von Dozenten wie auch Studierenden, vor allem in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Das mag mit den Kursen zusammenhängen, die gerade in den ersten zwei Jahren vor allem eines vermitteln: breites Überblickswissen und die Fähigkeit, kritisch und strukturiert zu denken.
Ich lerne zwar viel in meinen Seminaren, aber wenig Spezifisches. Ich schreibe wöchentlich Essays zu anderen Themen, indem ich mich schnellstmöglich immer in ein Thema einlese, das Gelesene analysiere und im Essay verarbeite. Es mag auch mit der Einstellung der Arbeitgeber zu tun haben, meint Dawn, Geschichtsstudentin im dritten Semester. „Was wir an der Universität für den späteren Beruf lernen, sind key skills.“ Das Studienfach scheint hier keine große Rolle zu spielen. Ich werde kaum danach gefragt und wenn, dann fragt niemand: „Was willst Du denn damit später mal machen?“ Ich muss mich nicht mit Praktika und Zukunftsplänen rechtfertigen und glaubte zuerst, dass dies schlicht mit der britischen Höflichkeit zusammenhängt. Dawn aber meint: „Eine Freundin ist gerade mit ihrem Geschichtsstudium fertig geworden und arbeitet jetzt als Analystin in einer Investmentbank. Ich habe gehört, dass 40 Prozent aller Geschichtsabsolventen im Investmentbereich arbeiten.“
Ed, Germanistikstudent im Abschlussjahr, fügt hinzu: „Die Universität und die Noten sind wichtiger als das Fach, das man studiert hat. Eine Freundin aus Spanien hat Jura studiert und ist jetzt enttäuscht, dass sie hier keine höheren Chancen auf einen Job hat, als eine Person, die Literatur studiert hat.“ Um ein möglichst umfassendes Bild der Absolventen zu präsentieren, hat Edinburgh dieses Jahr, wie viele andere britische Universitäten auch, eine Art Abschlussdiplom eingeführt, das nicht nur das Fach und die Noten, sondern auch außeruniversitäre Qualifikationen, wie soziales Engagement, enthält. Das organisierte „Socialising“, das studentische Engagement und die Struktur der Kurse fügen sich zu etwas zusammen, das meine Freunde hier „University experience“ nennen – ein Lebensabschnitt der Bildung und Ausbildung, eingerahmt vom sozialen Gefüge Universität. Allerdings bemerke ich, dass ich auch in Edinburgh nichts grundsätzlich anders mache, als in Heidelberg. Ich bin durch das Theater und die Zeitung sogar in den gleichen Societies. Die Rahmenbedingungen sind andere und doch muss ich feststellen, dass die Erfahrungen, die man an der Universität macht, so vielfältig sind wie die Studierenden selbst – und zu einem wesentlichen Teil davon abhängen, wie man die Rahmenbedingungen nutzt.
von Isabella Freilinger aus Edinburgh (Großbritannien)