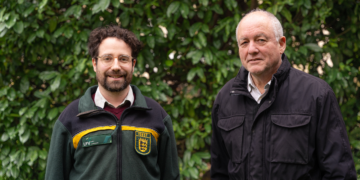Science Fiction und aktuelle Robotikforschung liegen noch weit auseinander – ein Besuch bei den Robotertagen im DAI.
[dropcap]S[/dropcap]ie führen eine romantische Beziehung mit all ihren Höhen und Tiefen, Eifersüchteleien und Leidenschaften: Theodore und Samantha. Auch dass ihre Beziehung allein auf Kommunikation beruht, unterscheidet sie nicht sonderlich von einer klassischen Fernbeziehung. Eines ist doch anders: Samantha ist ein Betriebssystem. Dies ist der Plot des Films „Her“ (2013) von Regisseur Spike Jonze. Der Protagonist Theodore, gespielt von Joaquin Phoenix, verliebt sich nach einer gescheiterten Beziehung in sein neues Betriebssystem, welches ihm mit der sanften Stimme von Scarlett Johansson das Leben verzaubert. Anlässlich der Robotertage zeigte das Heidelberger Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) den Film und lud ein zu Diskussion um die Zukunft der Künstlichen Intelligenz und Robotern in Alltag und Beruf. Auf dem zweitägigen Programm standen Vorträge, eine „Robotfair“, auf der das Heidelberger Lehrlabor ihre neuesten Produkte präsentierte und eine Podiumsdiskussion um die Auswirkungen von Robotern auf die Arbeitswelt zu beleuchten.
Im DAI wurde vor allem deutlich, wie groß die Unterschiede zwischen Realität und Science Fiction sind. Viel grundlegender als die Authentizität von simulierten Emotionen sind die Fragen, mit denen sich die aktuelle Robotikforschung auseinandersetzt. Die 2010 gegründete Heidelberger Forschungsgruppe „Optimierung in Robotik und Biomechanik“ um Prof. Katja Mombaur untersucht unter anderem, wie menschenähnliche Bewegungen auf Roboter übertragen werden können. „Wir wollen die Roboter verbessern, in dem wir vom Menschen lernen – wir wollen aber keine besseren Menschen schaffen“, betont Doktorand Benjamin Reh die Zielsetzung. In dem Projekt „Koroibot“ sollen sich die Roboter durch optimierte Bewegungen besser in für Menschen geschaffenen Umgebungen zurechtfinden. Die Forscher gehen von der Annahme aus, dass der Mensch durch seine Muskeln und Knochen optimal an seine Umwelt angepasst ist. Die Herausforderung besteht nun darin, mit einem anderen Werkstoff ähnliche Bewegungen zu ermöglichen.
Methodisch geht es um die mathematische Modellierung menschlicher Bewegungen. „Wir wollen abstrakt verstehen, wie beispielsweise die Bewegungen eines Beins beim Laufen funktionieren“, erläutert Sascha Tebben. Dabei sei noch viel Raum für Grundlagenforschung, da es sich insgesamt um eine relativ junge Disziplin handelt. In dem Projekt „Mobot“ erforscht er, wie die Erkenntnisse den Menschen in seinem Alltag unterstützen können: etwa Rollatoren, die Personen durch optimierte Bewegungen beim Aufstehen helfen.
Gerade die Entwicklung kollaborierender Systeme steht derzeit im Aufwind. Bei diesen Modellen geht es darum, dass durch das gelingende Zusammenwirken von Mensch und Maschine Prozesse möglich sind, zu denen weder die Technik noch der Mensch alleine im Stande wäre. „Tätigkeiten, die für Menschen zu stupide sind, also einfache, mechanische Tätigkeiten, aber auch zu anstrengende Tätigkeiten, können von humanoiden Robotern in Zusammenarbeit mit Menschen ausgeführt werden“, erklärt Mombaur. Damit dies möglich wird, müssen jedoch zunächst die Roboter sicherer gestaltet werden. Derzeit befinden sie sich meist in Käfigen, damit Arbeitnehmer nicht gefährdet werden.
Insgesamt sprechen Experten auch von einer „Humanisierung der Arbeit“, so auch Welf Schröter, der als Gewerkschaftler Unternehmen die „Industrie 4.0“ näherbringt. Auch Dominik Bösl von KUKA, dem europäischen Marktführer in der Herstellung von Industrierobotern, spricht von dem Ziel, „rote Arbeitsplätze zu automatisieren“ und bezieht sich damit auf die sichere Gestaltung der Arbeit. Bei der Podiumsdiskussion im DAI sprachen die beiden über die Auswirkungen der Roboter auf die Berufs- und Arbeitswelt.
Letztlich geht es jedoch nicht allein um die Bewältigung technischer Herausforderungen. Ein wachsendes Forschungsfeld setzt sich mit den Faktoren gelungener Mensch-Maschine-Interaktion auseinander. Eine aktuelle Studie von Zheng und Kollegen aus Hong Kong und Vancouver zeigte, dass, wenn Roboter gewisse menschliche Eigenschaften, wie nonverbale Kommunikation, beherrschen, die Interaktion mit Menschen fließender verläuft. Gemeint sind damit etwa Körpersprache, Kopf-, Augen- und Nackenbewegungen, die an die menschlichen Eigenschaften angepasst werden.
Die Steigerung der Akzeptanz über eine größere Ähnlichkeit zum Menschen hat jedoch seine Grenzen. Der Begriff des „Uncanny Valley“ (unheimliches Tal) bezeichnet diesen paradox anmutenden Effekt: Die Akzeptanz von Robotern und anderen autonomen technischen Systemen steigt zwar zunächst mit ihrer wachsenden menschlichen Ähnlichkeit an. Jedoch verzeichnet dieser positive Zusammenhang zu einem gewissen Punkt einen Einbruch. Erst bei einem sehr hohen Grad von Anthropomorphismus, wenn also kaum noch Unterschiede zu einem wirklichen Menschen merklich sind, steigt dieser wieder an.
Genau diesen Übergang zwischen Mensch und Maschine thematisierte der Heidelberger Romanistikprofessor Gerhard Poppenberg in seiner Analyse im Anschluss an den Film „Her“. Was unterscheidet ein echtes Gefühl von einem simulierten? Kann eine Beziehung allein auf Kommunikation beruhen?
In „Her“ verabschieden sich die Betriebssysteme geschlossen aus der menschlichen Welt, die ihnen nicht mehr genügte. Rasant wuchsen sie intellektuell jenen über den Kopf, die sie einst erschufen. Zurück bleibt eine Masse an unglücklich verliebten Menschen. Eine Parabel auf die Gefahr des Größenwahns? Verständlich, doch bei einem Blick auf die aktuelle Forschung bleibt dieses Szenario bis auf Weiteres Zukunftsmusik. Die Kosten für humanoide Roboter sind noch exorbitant, die Technikskepsis weiterhin groß.
Von Margarete Over